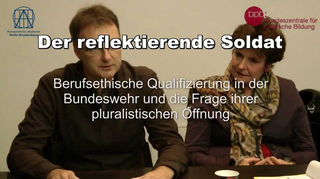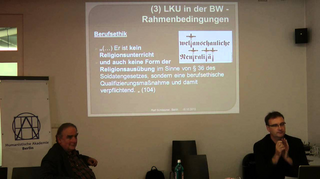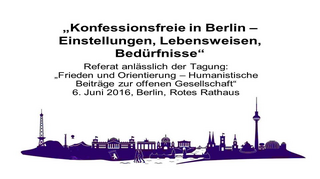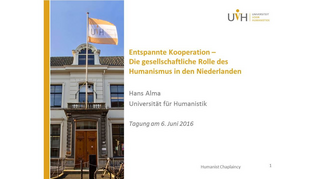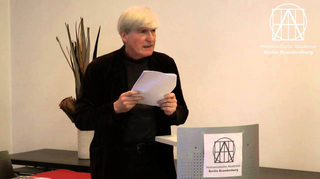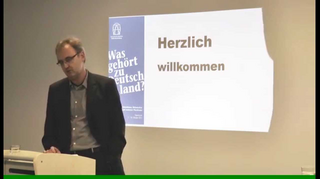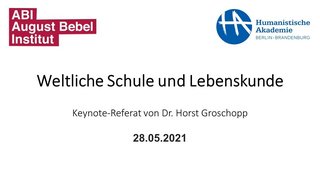Veranstaltungsberichte
Die Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg präsentiert Ihnen hier ihre Veranstaltungsberichte.
Auswahl mit Videos
Hier präsentieren wir ausgewählte Veranstaltungen der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg – viele davon mit Videos zum Nachschauen.
Im oberen Bereich finden Sie die letzte Veranstaltung. Die älteren Veranstaltungsberichte unten sind alphabetisch sortiert – klicken Sie einfach auf die jeweilige Überschrift.
23.10.2025: Von Tradwife zu Childfree. Lebensmodelle der Generation Z
Am 23. Oktober 2025 kamen rund 50 junge Menschen der Generation Z zusammen, um über ihre eigenen Lebensmodelle zu sprechen. Die Teilnehmer*innen aus verschiedensten sozialen, kulturellen und religiösen Kontexten diskutierten über Familienmodelle, Rollenbilder und Identität – und darüber, was all das mit Respekt, Toleranz und dem gesellschaftlichen Miteinander zu tun hat.
Der Projekttag startete mit zwei Workshops. Im Bewegungsworkshop „Behind the Box – zwischen Anpassung und Abgrenzung“ mit Tea Kolbe standen der Umgang mit den Erwartungen anderer und die Fähigkeit zur Abgrenzung im Mittelpunkt. Tanz und Bewegung dienten dabei als Medium, um Rollenbilder, Stereotype, Grenzen und Begegnungen körperlich erfahrbar zu machen. Die Teilnehmerinnen waren von Beginn an aktiv eingebunden und setzten sich dabei unter anderem mit dem Begriff „Weiblichkeit“ und seinen Bedeutungen auseinander.
Im Workshop „TikTok gegen die Vielfalt?“ mit Karl Eckardt wurden die Ideologien und Strategien demokratiefeindlicher Akteur*innen auf Social Media beleuchtet. Im Fokus standen spezifische Rollenbilder und Feindbildkonstruktionen; deren angestrebte Ziele durch subtile und offensive Beeinflussung der User*innen. Demgemäß bildete die Auseinandersetzung mit konkreten Beispielen von Antifeminismus auf TikTok den zentralen partizipativen Schwerpunkt des Workshops für die Teilnehmenden. Die Gruppe bildete auch einen kleinen Teil der Realität ab, in dem sie sich zu Soziometrischen-Fragen positionierte und dazu diskutierte.
Die Gesprächsrunde „Lebensmodelle der Generation Z“ begann mit einem Input-Vortrag von Ole Liebl zum Thema „Freunde lieben“. Der Autor und Video-Creator beleuchtete die Beziehungsform „Freundschaft plus“ aus wissenschaftlicher Perspektive. Anschließend diskutierten Teilnehmer*innen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Weltanschauungen miteinander: Melissa Altmis vom Jungen Forum der Religionen, Adva Cotani-Lehmann aus dem Projekt „Zusammen interreligiös in Treptow-Köpenick“ der Kommunalen Ökumene sowie Kolja Brachhaus, der die Jungen Humanist*innen vertrat.
Die erweiterte Fishbowl-Runde wurde von vielen Teilnehmer*innen aktiv genutzt. Dabei wurde nicht nur über verschiedene Lebensmodelle gesprochen, sondern auch darüber, wie realistisch es ist, diese in der Gesellschaft tatsächlich auszuleben. Deutlich wurde ein Spannungsfeld zwischen einerseits vielfältigen Möglichkeiten und andererseits einer Umwelt, die von Krisen und Konflikten geprägt ist.
Zwar zeigt sich die Gesellschaft offener für gelebte Vielfalt, dennoch wird die Ehe weiterhin als gesellschaftlich und finanziell begünstigtes Modell gefördert. Gemeinsam wurde festgehalten, dass Gemeinschaft für jeden Menschen - egal welcher Generation - essenziell ist und soziale Sicherheit die Grundlage aller Lebensentwürfe bildet. Die Runde bot Raum, um über solidarische Formen des Zusammenlebens nachzudenken und sich dafür starkzumachen.
Die rund 50 Teilnehmendem waren aktiv dabei, diskutierten divers, aber immer Respekt vor den Erfahrungen und Meinungen anderer! Die Moderation führte Tina Bär.

Die Suche nach dem Anfang der Welt beschäftigt Menschen schon seit Jahrtausenden. Und am 30. November 2016 kamen im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel 50 interessierte Teilnehmer*innen zusammen, um im Hier und Jetzt mehr über diese Suche zu erfahren.
Der Astronom und langjährige Leiter der Archenhold-Sternwarte, Prof. Dr. Dieter B. Herrmann, berichtete mit faszinierenden Bildern über die gegenwärtigen Vorstellungen von der Lebensgeschichte des Weltalls und über das Standardmodell der Mikrowelt:
- Welche Thesen verfolgen die Wissenschaftler*innen heute zur Entwicklung des Universums?
- Wie hängen verschiedene Beobachtungen zusammen?
- Welche Fragen sind geklärt, welche noch völlig offen?
Nach einer umfangreichen Einführung zum Stand der Wissenschaft wurde an diesem Abend deutlich, wie die gegenwärtigen „Urknall-Experimente“ im riesigen Teilchenbeschleuniger in Genf zu verstehen sind und wie sie unsere Vorstellungen über unsere Welt und damit über uns selbst verändern, erweitern und bereichern können.
Nach dem Vortrag beteiligten sich viele Gäste an der sehr regen Diskussion, die am Schluss dann noch sehr philosophisch wurde und zum Nachdenken und Weiterdenken anregte, wie begrenzt unser Wissen ist und wie begrenzt unsere Vorstellungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, die richtigen Fragen zu stellen.
Veranstalter:
Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V. in Kooperation mit der Humanistischen Akademie und dem Fachbereich Kultur der Stadt Brandenburg an der Havel, gefördert mit Mitteln der Humanismus-Stiftung
Eine Diskussion über den „Lebenskundlichen Unterricht“ in der Bundeswehr nach der 2012 in Kraft getretenen Zentralen Dienstvorschrift 10/4 aus dem Jahre 2009
18. November 2013, 18:00 Uhr:
Begrüßung und Eröffnung durch Ralf Schöppner
Redebeitrag von Ralf Schöppner
18:30 Uhr:
Vortrag „Humanistische Soldatenberatung in Belgien“
Annie van Paemel
Redebeitrag von Annie van Paemel
19. Oktober 2013, 9:30 Uhr:
Vortrag „Weltanschaulicher Pluralismus im Lebenskundlichen Unterricht der Bundeswehr“
Klaus Ebeling
Redebeitrag von Klaus Ebeling
13:30 Uhr:
Podium „Impulsreferate – Zwischentöne zu einer humanistischen Soldatenberatung“
Dr. Thomas Heinrichs und Dr. Bruno Osuch
13:30 Uhr:
Podium „Impulsreferate – Zwischentöne zu einer humanistischen Soldatenberatung“
Dr. Thomas Heinrichs und Dr. Bruno Osuch
In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, gefördert durch das Land Berlin.

Jugendliche haben ihren ganz eigenen Blick auf Krieg und Frieden und die Welt, in der sie leben:
- Wie entstehen Kriege?
- Wie lässt sich Frieden sichern und was gesellschaftlich und persönlich dazu beitragen?
- Welche Konflikte entstehen zwischen Andersseienden?
- Wie kann mit fremdenfeindlichen und diskriminierenden Tendenzen umgegangen werden?
Am 5. September 2016 gestalteten Jugendliche aus Indien und Brandenburg für die interessierte Öffentlichkeit der Region gemeinsam eine interkulturelle öffentliche Präsentation zu diesen Fragen. Vorarbeit zu der Veranstaltung wurde im Rahmen des deutsch-indischen Jugendaustauschs geleistet und für die Veranstaltung wurden eigene Theatersequenzen und Vorträge erarbeitet.
In Kooperation mit dem Humanistischen Freidenkerbund Havelland e.V., gefördert von der Humanismus Stiftung Berlin.

Jugendliche Teilnehmer*innen halten ihre Präsentation.

Programm:
10:00 bis 10:45 Uhr:
„Konfessionsfreie in Berlin – Einstellungen, Lebensweisen, Bedürfnisse“
Präsentation der Ergebnisse einer neuen Emnid-Befragung
Carsten Frerk, Journalist und Autor
11:00 bis 11:45 Uhr:
„Weltanschaulich-religiöse Vielfalt in Deutschland – Probleme und Chancen für das Zusammenleben“
Detlef Pollack, Universität Münster
12:00 bis 13:00 Uhr:
Entspannte Kooperation. Die gesellschaftliche Rolle des Humanismus in den Niederlanden
Hans Alma, University of Humanistic Studies, Utrecht
13:00 Uhr:
Grußwort
Tim Renner, Staatssekretär für Kultur
13:05 bis 14:00 Uhr:
Mittagspause
14:00 bis 14:30 Uhr:
Markt der Weltanschauungen
Stände der Organisationen
14:30 bis 15:30 Uhr:
Lebenskunst und integrative Gesellschaft
Wilhelm Schmid, Universität Erfurt
5:30 bis 16:00 Uhr:
Kaffeepause
16:00 bis 16:45 Uhr:
Podiumsdiskussion „Humanismus als Leitbild pluralistischer Gesellschaften?“
Wilhelm Schmid, Universität Erfurt, Martin Beck, Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg und Carsten Frerk, Giordano-Bruno-Stiftung
Moderation: Catherine Newmark, Freie Universität Berlin, Autorin und Redakteurin beim Deutschlandradio Kultur und „Philosophie Magazin“
16:45 bis 17:30 Uhr:
Markt der Weltanschauungen
Stände der Organisationen
Veranstalter:
In Kooperation mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, der Humanismus Stiftung Berlin und den evolutionären Humanisten Berlin-Brandenburg e. V.

Eine wissenschaftliche Tagung der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg und des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg KdöR
Mehr als 50 Gäste wollten inmitten des bedrückenden Corona-Wahnsinns am 19. und 20. November 2021 wissen, was Humanistik ist und wofür man das braucht. Referent*innen und Gäste gaben auf der digitalen Tagung der Humanistischen Akademie und des Humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg eine Reihe überzeugender Antworten.
Humanistik ist die Bezeichnung für eine in den Niederlanden und Belgien etablierte transdisziplinäre Wissenschaft, die Humanismus beforscht und humanistische Praktiker*innen ausbildet. Sie steht dort gleichberechtigt neben theologischen Studiengängen. Wiel Veugelers von der Universität für Humanistik in Utrecht stellte ein eindrucksvoll vielseitiges Forschungsprogramm vor und verwies auf die vielen Einsatzmöglichkeiten der Absolvent*innen in Schulen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen. In den Niederlanden habe die Humanistik zu einer akademischen Professionalisierung pädagogischer und sozialer Berufe beigetragen, nicht zuletzt durch die erweiterten Möglichkeiten, Praxis mit Forschung zu verbinden.
In Deutschland gibt es das trotz der hohen Anzahl nichtreligiöser Menschen bislang nicht. Theologie ist an deutschen Hochschulen verankert, Humanistik aber nicht. Dies will der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg KdöR ändern. In Gründung befindet sich die von ihm betriebene Humanistische Hochschule Berlin. Verläuft der Gründungsprozess erfolgreich, so könnten ab dem Wintersemester 2022/2023 in Berlin Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen, ethische Fachkräfte und weitere Berufsgruppen ausgebildet werden. Mittelfristig wird aber nicht nur eine Stadt wie Berlin auch Humanistik-Lehrstühle an den Universitäten einrichten müssen, um einer einseitigen Bevorzugung religiöser Menschen und Institutionen entgegenzuwirken.
Julian Nida-Rümelin, Philosoph und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, hob die Bedeutung der Menschenrechte als erfolgreichstes Projekt humanistischen Denkens und humanistischer Ethik hervor. Sie hätten eine wohlbegründete universelle Geltung und seien das normative Fundament der Weltgesellschaft, wenngleich allzu oft nicht eingelöst. Ohne dass der ehemalige Kulturstaatsminister sich auf Humanistik bezog, zeigten doch gerade seine Ausführungen zu (auch) europäischen Irrwegen wie Kolonialismus, Rassismus und Sexismus sowie zu den gegenwärtigen antihumanistischen Tendenzen – Querdenkerei, Antidemokratie, Neoliberalismus, Identitätspolitik, Teile der KI-Forschung – eine deutliche Nähe zu einem Kernanliegen der Humanistik. Denn diese will kein Elfenbeinturm sein, sondern in die Gesellschaft hineinwirken, beitragen zur Gestaltung gemeinsamer politischer Rahmenbedingungen und zu einem gelingenden Zusammenleben der vielen Verschiedenen.
Dass Humanistik auch ein Sinnangebot bei existenziellen Fragen und in menschlichen Nöten sein kann, deutete Tatjana Schnell an. Die Professorin für Religionspsychologie und existenzielle Psychologie in Innsbruck und Oslo präsentierte den Gästen die Ergebnisse ihrer empirischen Studie zum Sinnerleben nichtreligiöser Menschen: Jene, die sich selbst primär als Humanist*innen bezeichnen, empfänden aufgrund ihrer Weltanschauung ihr Leben tendenziell sinnerfüllter als solche, die sich primär selbst als Atheist*innen und Agnostiker*innen bezeichnen. Auch die Korrelation mit seelischer Gesundheit falle nach Selbstauskunft der Befragten bei Humanist*innen höher aus.
1. Tagungstag – Videomitschnitt
Im Humanismus gibt es keine Dogmatik, so Frieder Otto Wolf, Honorarprofessor an der FU Berlin und Präsident der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg. Dies sei der wesentliche Unterschied zu den Religionen. In seinem für die Konzeption einer Humanistik grundlegenden Beitrag erteilte er dem theoretischen Humanismus eine Absage zugunsten des praktischen Humanismus. Gemeint sei damit keineswegs der Verzicht auf theoretische Arbeit, wohl aber derjenige auf die unhistorische Bestimmung eines allzu engen Menschenbildes, das exkludierende Wirkungen entfalten könnte. Auch eine praxisorientierte Humanistische Fachhochschule sei ein Ort für die intensive Reflexion und wissenschaftliche Beforschung humanistischer Praxis.
Das Unterrichtsfach Humanistische Lebenskunde ist mit seinen circa 70.000 Grundschüler*innen in Berlin ein Erfolgsmodell. Seit vielen Jahren bildet der Humanistische Verband seine Lehrkräfte in eigener Regie hochprofessionell aus. Es ist nicht einsichtig, warum es hier – anders als für die knapp 6.000 Schüler*innen im Islamunterricht – nicht schon längst eine Verankerung an einer eigenen Hochschule oder Universität gibt. Steffen Kohl und Martin Mettin vom Ausbildungsinstitut des Humanistischen Verbandes stellten auf der Tagung nochmals eindrucksvoll heraus, warum das Fach bei Schüler*innen so beliebt ist: Anknüpfung an deren konkrete Lebenswelten, Betonung der Beziehungsebenen, Raum für Kreativität, kritisches Denken, Erfahrung, Entwicklung und vor allem auch Sinnfragen. Von einer Humanistischen Hochschule verspricht man sich neben der weiteren akademischen Fundierung der Ausbildung der Lehrkräfte auch starke Impulse durch Unterrichtsforschung und für ein modernes Verständnis von praktischer humanistischer Bildung.
Tagung Tag 1 „Humanistik – für ein sinnvolles Leben in einer menschlichen Gesellschaft“
2. Tagungstag – Videomitschnitt
Die Tagung stieß auch bei Medienvertreter*innen auf Resonanz. Pascal Fischer fragt in seinem Beitrag zur Tagung im Deutschlandfunk zu Recht kritisch nach, warum man angesichts der vorhandenen Humanwissenschaften zusätzlich noch eine Humanistik braucht. Dass diese Frage angesichts von Religionswissenschaft, Religionssoziologie, Religionspsychologie und so weiter ja auch nicht an die Theologie adressiert wird, dürfte hier als Antwort nicht ausreichen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Humanwissenschaften jeweils nur ausgewählte Ausschnitte der Wirklichkeit untersuchen und spezifisch abgegrenzte Erkenntnisgegenstände isolieren. Dabei zielen sie auf objektivierbare, akteursunabhängige Bedeutungen. Humanistik dagegen fragt nach dem „Ganzen“, nach der Stellung des Menschen im Ganzen der Welt und den Bedeutungen, die Menschen ihrer Existenz in dieser Welt beimessen können. Humanistik hat eine sinnstiftende Dimension.
Die Tagung war geprägt von sehr konzentrierten Debatten, die sowohl die konzeptuellen wie auch die praktischen Seiten durchleuchteten. Mit Blick auf die Niederlande und unter Berücksichtigung der Situation in Deutschland wurde die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer engagierten Wissenschaft auch hierzulande argumentativ untermauert. Es bedarf auch hier der akademisch verankerten Reflexion und wissenschaftlichen Beforschung der Theorie und Praxis des Humanismus, insbesondere auch seiner Berufsfelder. Humanistik stellt darüber hinaus aber auch Orientierungswissen in zweifacher Hinsicht bereit. Zum einen Orientierung für die Einzelnen in Bezug auf Sinnfragen, zum zweiten Orientierung für ein gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben der vielen Verschiedenen.
Ralf Schöppner
Tagung Tag 2 „Humanistik – für ein sinnvolles Leben in einer menschlichen Gesellschaft“
9:30 Uhr:
Eröffnung und Begrüßung
Moderation: Dr. Ralf Schöppner
9:45 Uhr:
Vortrag „Plädoyer für einen schwachen Transhumanismus“
Dr. Stefan Lorenz Sorgner
Redebeiträge von Ralf Schöppner und Stefan Lorenz Sorgner
11:30 Uhr:
Vortrag „Transhumanismus in philosophisch-anthropologischer Perspektive“
Prof. Dr. Joachim Fischer, Dresden
Joachim Fischer
14:00 Uhr Vortrag
Video: „Transhumanismus« – Version oder Perversion des Humanismus?“
Prof. em. Dr. Enno Rudolph, Luzern
Redebeitrag von Enno Rudolph
15:45 Uhr:
Abschlusspodium „Humanismus und Utopie“
Dr. Sorin Antohi, Dr. Stefan Lorenz Sorgner, Prof. Dr. Joachim Fischer und Prof. em. Dr. Enno Rudolph
Redebeiträge von Sorin Antohi, Stefan Lorenz Sorgner, Joachim Fischer und Enno Rudolph
In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, gefördert durch das Land Berlin.

Flucht und Migration aus Krisengebieten, Bomben auf das Kalifat, die Taliban zurück in Kundus, deutsche Waffen für irakische Kurden. Die internationalen Konflikte und Krisen werfen eine Reihe von Fragen auf, mit denen sich die Tagung beschäftigte:
- Wie hängen aktuelle Fluchtbewegungen und vergangene militärische Interventionen zusammen?
- Wie erfolgreich waren die sogenannten humanitären Interventionen nach dem Ende des Kalten Krieges?
- Wie sind solche Interventionen völkerrechtlich und ethisch zu bewerten?
- Welche Rolle soll Deutschland und die Bundeswehr dabei spielen?
- Mit welchen friedenspädagogischen Strategien muss Jugend- und Bildungsarbeit auf die Widerspiegelungen der Konflikte in den Mikrokosmen einer polykulturellen Stadt wie Berlin antworten?
- Wie reagiert man auf die zunehmende Radikalisierung und den Antisemitismus in manchen muslimischen Milieus?
- Kurzum: Was bedeutet humanistische Verantwortung in internationalen Konflikten angesichts aktueller Fluchtbewegungen?
Vortrag „Flüchtlinge in Deutschland – Probleme und Chancen“
Wolfgang Wieland, Beirat für Zusammenarbeit, Berlin
Redebeitrag Wolfgang Wieland
Diskussion „Flüchtlinge in Deutschland - Probleme und Chancen“
Diskussion
Vortrag „Kooperative Verantwortung oder nationale Interessenspolitik?“
Prof. em. Dr. Andreas Zumach, Publizist und Journalist
Redebeitrag von Andreas Zumach
Véronique Zanetti: Kollektive Verantwortung in internationalen Krisen
Ansätze und Positionen einer humanistischen Friedensethik
Redebeitrag von Prof. Dr. Véronique Zanetti
Abschlussdiskussion
Abschlussdiskussion
Videos: Frank Spade
In Kooperation mit der Humanistischen Akademie Deutschland, dem Humanistischen Verband Deutschlands - Berlin-Brandenburg, gefördert von der Bundeszentrale der Politischen Bildung, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und der Humanismus Stiftung Berlin.
Aufsatz von Thomas Heinrichs und Ralf Schöppner
Zusammenfassung:
Zeitgenössische friedensethische und friedenspolitische Positionen stehen oftmals implizit in einer humanistischen Tradition. Sie werden hier in Beziehung gesetzt zu einer bislang nur in Ansätzen vorhandenen, sich explizit humanistisch nennenden Friedensethik. In ethischer Hinsicht wird dabei ein weiter, interpersonal grundierter Begriff von Gewaltfreiheit stark gemacht. Entfaltet werden dessen politische Implikationen für das primäre humanistische Ziel einer friedlichen gesellschaftlichen Ordnung sowie für Grundvoraussetzungen einer politisch opportunen, wenn auch ethisch nicht zu rechtfertigenden Einschränkung des Prinzips der Gewaltfreiheit in Ausnahmefällen.
Den vollständigen Aufsatz finden Sie nachfolgend als PDF-Datei:

Zur gemeinsamen Tagung von Friedrich-Ebert-Stiftung und Humanistischer Akademie versammelten sich am 27. Oktober 2016 annähernd 100 Gäste in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin.
Im ersten Panel warf zunächst Prof. Dr. Riem Spielhaus, Islamwissenschaftlerin von der Georg-August-Universität Göttingen, einen kritischen Blick auf die Debatte um Werte. Diese würden oftmals als Mittel zur Ausgrenzung anderer benutzt, wozu insbesondere die mit ihnen transportierte „Semantik des Eigentlichen“ (H. Bielefeldt) beitrage. Demgegenüber verwies sie auf die Bedeutung von konkreten Aushandlungsprozessen im Alltag. Statt von einer Einwanderungsgesellschaft sprach sie von einer postmigrantischen Gesellschaft: Es sei frappierend, dass die zahlreichen Zuwanderer*innen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland leben oder sogar hier geboren sind, in den Einwanderungsdiskursen stets unter „Migranten“ mitsubsumiert würden.
Dr. Ralf Schöppner, Philosoph und Geschäftsführender Direktor der Humanistischen Akademie, stellte den Gästen einige zentrale Elemente eines zeitgenössischen Humanismus vor. In einem aktuell diskutierten Entwurf des Humanistischen Verbandes stünden Lebensfreude und Selbstbestimmung, „Brennen“ für eine bessere Welt, Kritik und Toleranz sowie Weltlichkeit im Mittelpunkt. Auch bei ihm war eine Vorsicht zu bemerken, sich unkritisch auf herrschende Wertediskurse einzulassen. Er plädierte dafür, genau zu erkunden, welche neuartigen Integrationsherausforderungen die aktuellen Flucht- und Migrationsbewegungen wirklich darstellen. Humanistische Integration setze zum einen auf an Menschenrechte gebundene Rechtsstaatlichkeit und sozio-ökonomische Integration, also Arbeit, Wohnen, Sprache und Beziehung. Zum anderen aber gehe es insbesondere um die wechselseitige Bereitschaft, sich auf gemeinsame Beratungen über Lebensformen und Zusammenleben einzulassen und dabei nicht nur am eigenen Standpunkt zu kleben. Dies sei eine von humanistischen Organisationen zu vermittelnde Kompetenz, in der sich humanistische Überzeugungen und Werte kristallisierten.
Aus der anschließenden Diskussion mit dem Publikum ist besonders hervorzuheben, dass viele Gäste in ihren Redebeiträgen den Wunsch nach einem vehementeren Eintreten für die Werte der deutschen Verfassung bekundeten. Angesichts der offenen Dialogbereitschaft von deutschen Linksliberalen würden sich radikale Islamist*innen ins Fäustchen lachen. Gewünscht wurde unter anderem auch ein resolutes humanistisches Bekenntnis zur Polizei.
Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Nicole Immler von der Utrechter Universität für Humanistik berichtete zu Beginn des zweiten Panels von ihren Forschungen zu interkulturellen Diskursen in den Niederlanden. Unter dem Motto „Was der Pluralismus vom Humanismus lernen kann“ vollzog sie anhand zweier praktischer Beispiele einen interessanten Perspektivwechsel weg von den Einwandernden hin zu den Einheimischen. Die öffentlichen kollektiven Feiern zum „schwarzen Piet“ zeigten einen unterschwelligen Rassismus und die Debatten um zum Beispiel Einwander*innen aus Indonesien entbehrten jeglicher Reflektion des eigenen kolonialen Erbes. Auch nach vielen Jahren der Einwanderung seien Einwandernde in den Niederlanden nach wie vor in vielen zentralen gesellschaftlichen Bereichen unsichtbar. Dies sei ein großes Hindernis für Austausch, für wirkliche Interkulturalität und gesellschaftlichen Pluralismus. Den Menschenrechten wies sie die Aufgabe zu, eine „gemeinsame neutrale Sprache“ zu sein.
Dr. René Cuperus, Direktor der Wiardi Beckman-Stiftung Amsterdam, einem Think Tank der niederländischen Arbeiterpartei, kurz PvdA, belebte die Diskussion mit seiner These, die Vertreter*innen multi- und interkultureller Konzepte seien „Brandstifter des europäischen Rechtspopulismus“. Es handele sich um ein gefährliches Denken der intellektuellen Klasse mit „aggressiven Begriffen“ für Eingesessene. Stattdessen plädierte er für eine Leitkultur und den Dreischritt von Assimilation, Partizipation und kultureller/religiöser Freiheit. An erster Stelle steht für ihn die notwendige Anpassung der Einwander*innen an die Grundregeln des demokratischen Rechtsstaates und die Einübung in Toleranz. Des Weiteren diagnostizierte Cuperus speziell in den Niederlanden einen Mangel an Respekt für Religion und Tradition, der im Zusammenhang stehe mit der Konfessionsfreiheit als gesellschaftlicher Mehrheit und der seinen Ausdruck auch in verbreiteter Islamophobie finde.
Arne Lietz, Mitglied der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, hob die Bedeutung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften für den Prozess der europäischen Einigung hervor. Er stellte dem Auditorium einen „Aufruf zum aktiven Handeln gegen die weltweite Verfolgung religiöser Minderheiten“ vor, unterschrieben von Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, die sich ganz unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen verbunden fühlen. Im Gegensatz zu vielen anderen öffentlichen Verlautbarungen zur Religionsfreiheit wird in diesem Aufruf erfreulicherweise auch auf den Schutz der Freiheit, keiner Religion anzugehören, hingewiesen. Ein Punkt, den Lietz auch mündlich nochmals besonders hervorhob.

Ralf Schöppner am Redepult.
Nicht überraschend stand dann in der Diskussion des zweiten Panels die provokante These von Cuperus im Vordergrund. Viele Gäste äußerten sich zustimmend und dankbar, dass „hier mal jemand die Dinge beim Namen nennt“. Der Forderung nach einer Leitkultur wurde in den Beiträgen jedoch auch der Wunsch nach kultureller Vielstimmigkeit und zusammenhaltfördernder gemeinsamer Praxis gegenübergestellt. Tendenziell einig war man sich über die Problematik einer europaweit zunehmenden Kluft zwischen Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen, begleitet von mangelndem Vertrauen in die sogenannten herrschenden Eliten. Ob dem europäischen Rechtsruck allerdings am besten damit zu begegnen ist, Multi- und Interkulturalismus als dessen „Brandstifter“ verantwortlich zu machen, oder ob man sich damit nicht vielmehr selbst als „Brandbeschleuniger“ betätigt und dem Ressentiment den Persilschein ausstellt, musste an diesem Abend offen bleiben.
Xenia Alvarez
In Kooperation mit der Humanistischen Akademie Deutschland und dem Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung, gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.
Eindrücke von einer Tagung der Humanistischen Akademien zum Entwurf eines neuen humanistischen Selbstverständnisses
Am 27. Februar 2016 diskutierten auf Einladung der Humanistischen Akademien und des Berlin-Brandenburgischen Landesverbandes des Humanistischen Verbands Deutschlands etwa 40 Gäste den vorliegenden Entwurf für ein neues Humanistisches Selbstverständnis. Grundtenor in den Räumen der Humanistischen Fachschule für Sozialpädagogik: Der Text bietet allerhand Stoff für spannende und kontroverse Auseinandersetzungen, es gibt grundsätzliche Zustimmung bei gleichzeitigem Diskussionsbedarf in Einzelfragen.
Am Vormittag gab es fünf Impulsreferate zu bekannten strittigen Fragen, die sowohl ihr jeweiliges Thema grundsätzlich behandelten als auch direkt auf den vorliegenden Text Bezug nahmen.
Trennschärfe
Horst Junginger, Religionswissenschaftler an der Universität Leipzig, beantwortete die ihm gestellte Frage „Humanismus und Religion – eine Opposition?“ mit einem klaren „Ja und Nein“. Die Abgrenzung zur Religion eigne sich zur Herstellung von Trennschärfe in einem humanistischen Selbstverständnis eher nicht, weil zum einen das religiöse Feld heterogen und starkem historischem Wandel unterworfen sei, zum anderen „Religionen selbstverständlich Anteil am Humanismus und seiner Weiterentwicklung haben“. Für die humanistische Profilierung verwies Junginger stattdessen auf spezifische Forschungs- und Entwicklungsbedarfe bei den nichtkognitiven Aspekten säkularer Lebensführung, der besonderen Qualität nicht-religiöser Kunst, Literatur und Musik, bei der weltlichen Feiergestaltung sowie zeitgemäßen Formen humanistischer Vergemeinschaftung. Für Europa liege die Möglichkeit einer weltanschaulichen Gemeinsamkeit eher im Humanismus als in der Religion, die ja letztendlich auch auf der Autonomie menschlicher Normsetzung fuße. So dürfe sich ein humanistisches Selbstverständnis durchaus noch selbstbewusster geben und auch noch deutlicher nach außen für ein Mitmachen werben.
Wissenschaft und Weltanschauung
Gerhard Engel, Präsident der Humanistischen Akademie Bayern und Mitherausgeber der Zeitschrift Aufklärung und Kritik, warb für wechselseitige Lernprozesse von Wissenschaften und Humanismus. Von den Naturwissenschaften könne man das methodische Vorgehen – „Erkenntnisfortschritt durch Kritik und Innovation“ – lernen, von den Sozial- und Geisteswissenschaften die „Einbeziehung des Anderen“ und die „Entdeckung neuer Wirklichkeitsebenen“. Wissenschaftliches Vorgehen eigne sich zum Unterlaufen von Dogmatik, ohne doch selbst einen Religionsersatz bereitzustellen. Die Sozial- und Geisteswissenschaften ermöglichten die “Überwindung eines halbierten Darwinismus“.
Frieder Otto Wolf, Philosoph und Präsident der Humanistischen Akademie Deutschland, referierte die vielgestaltige und politisch brisante Geschichte des deutschen Weltanschauungsbegriffs. Dabei vermied er es, den Begriff als historisch „verbrannt“ ad acta zu legen und nannte einige Kriterien für eine sinnvolle Nutzung. Zum Teil auch entgegen des Wortsinnes seien insbesondere zu betonen ein deutlicher Praxisbezug, dialogische Offenheit und Geschichtlichkeit. Humanismus als Weltanschauung sei mehr als Humanität, weil es um einen Bezug auf das Ganze des menschlichen Lebens gehe, um die Frage eines sinnvollen und guten Lebens überhaupt. Dabei spiele die Durchsetzung von Menschenrechten eine entscheidende Rolle und dort verlaufe auch die Trennlinie zwischen religiösen Humanismen und nicht-humanistischer Religion.
Gender und aktiver Pluralismus
Helen Weinbach, Professorin an der Hochschule Rhein-Waal und Mitglied im nordrhein-westfälischen Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung, kritisierte das Namedropping im Entwurf (Kant und Co.) und ließ es sich nicht nehmen, sowohl die „patriarchalischen“ Frauenbilder einiger der dort genannten Philosophen und Wissenschaftler herauszustellen als auch überhaupt den Bezug auf Autoritäten zu hinterfragen. Der im Textentwurf durchaus versuchte Einbezug von Humanistinnen sei ebenfalls misslungen. Noch grundsätzlicher äußerte sie den Eindruck, dass in atheistischen und insbesondere evolutionsbiologischen Kreisen ein merkwürdig biologistisches Frauenbild vorherrsche. Interessant war hier vor allem, dass viele männliche Gäste ablehnend ihre Köpfe schüttelten, während die meisten weiblichen Gäste eifrig nickten. Dieses Thema gehört anscheinend dringend auf die humanistische Diskussionsagenda.
Hans Alma, Professorin an der Utrechter Universität für Humanistik, löste den möglichen Widerspruch von „Wahrheitsansprüchen und Toleranz“ durch ihre Bestimmung von Humanismus als eines aktiven Pluralismus auf. Anders als ein passiver Pluralismus – Neutralität, Weltanschauung als Privatsache – ziele aktiver Pluralismus auf Dialog und engagierte Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen bis hin zu „letzten Fragen“ (Werte, Ziele, Sinn) auch im öffentlichen Raum. Humanismus frage in einer Zeit der Unsicherheit selbstverständlich nach Wahrheit, wofür es aber der Prozesse des Dialoges, des Meinungsstreits und der Kooperation sowie einer Kultivierung der Sensibilität für „letzte Fragen“ bedürfe.
Vielstimmigkeit
Am Nachmittag hatten die Tagungsteilnehmenden ausführlich Gelegenheit, in wechselnden Zusammensetzungen an vier Dialogtischen zu sämtlichen Abschnitten des vorliegenden Textentwurfs miteinander zu debattieren.
Eine gute Nachricht lautet: Humanist*innen sind eine heterogene Gruppe. Vielstimmigkeit war die typische Erfahrung an den Dialogtischen. Fand zum Beispiel jemand den Begriff „humanistischer Eigensinn“ ausgezeichnet und profilscharf, so gab eine andere sofort dessen Missverständlichkeit zu bedenken und schlug „Freiheit“, „Selbstbewusstsein“ oder „Urteilskraft“ als Alternativen vor. Plädierte jemand für eine deutliche Kürzung des Abschnitts zur „humanistischen Sensibilität“, betonte ein anderer die Wichtigkeit gerade dieser Passagen. Argumentierte jemand, der Humanismus-Teil müsse vor dem Praxis-Teil kommen, äußerte eine andere die Überzeugung, dass die Reihenfolge der Kapitel auf jeden Fall so bleibe müsse.
Hier ließe sich eine lange Reihe weiterer und viel kleinteiliger Beispiele wie spezifische Formulierungswünsche, Ansichten und Themen anführen. Gerade in Bezug auf Letztere wird es bei allen Beteiligten entscheidend darauf ankommen, in den weiteren Diskussions- und Entscheidungsprozessen eine Perspektive einzunehmen, die auch über die je eigenen Prioritäten hinausgeht und alle verbandsrelevanten Akteure im Blick hat. Die Überlegung wird nicht so sehr sein können, ob ich mich selber möglichst vollständig mit all meinen Präferenzen in diesem Text wiederfinde, sondern wie der Text für alle Mitglieder und Mitarbeiter*innen zustimmungsfähig sein kann.
Bei manchen Fragen zeigten sich auch weniger uneindeutige Tendenzen, in welche Richtung der Text verbessert werden könnte. So wünschten zum Beispiel viele statt der nur impliziten Berücksichtigung der spezifischen Verbandstradition im Rahmen der historischen Gesamttradition von Humanismus eine explizitere Erwähnung. Öfter zu hören war auch der Zweifel an der Attraktivität des Textes nach außen sowie der Wunsch nach einer stärkeren Akzentuierung des politischen Engagements des Humanismus für die großen gesellschaftspolitischen Fragen der Zeit. Und nicht zuletzt ist sicherlich auch die Frage nach Trennschärfe und Alleinstellungsmerkmal weiter zu diskutieren.
Wie dem auch sei und schließlich sein wird, eine zweite gute Nachricht lässt sich als Fazit der Tagung festhalten: „Es lohnt sich, über diesen Text zu diskutieren“ war eine oft gehörte Aussage an diesem Tag. Der Text bietet Möglichkeiten gemeinsamen Nachdenkens und kontroversen Ringens um Standpunkte. Dazu sei auch hiermit nochmals ermuntert und eingeladen.
Ralf Schöppner

Ganz Deutschland feierte am 31. Oktober 2017 Martin Luther und das Reformationsjubiläum. Ganz Deutschland? Nein, ein kleines humanistisches Dorf versammelte sich auf Einladung der Humanistischen Akademie in der Berliner Urania, um einen kritischen Blick auf Geschichte und Gegenwart von Religion und Weltanschauung zu werfen. Und nicht zu vergessen: Die große Mehrheit im Lande dürfte schlichtweg nur einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag genossen haben.
Eine ganze Dekade lang wurde auf das 500. Jubiläum der als Reformationsbeginn betrachteten Veröffentlichung der lutherschen Thesen hin gefeiert. Unberücksichtigt blieb dabei vielerlei: Luthers religiöser Dogmatismus und politischer Autoritarismus, sein Frauen- und Familienbild, die innere Vielfalt der reformatorischen Bewegung und des Protestantismus, die Entfesselung eines brutalen konfessionellen Fundamentalismus, die historische Einbettung der Reformation in Neuzeit und Renaissance, die humanistisch-säkularen Beiträge zur Entwicklung der modernen Kultur. Und übertrieben wurde sicherlich auch die Relevanz des Protestantismus für aktuelle gesellschaftliche und globale Krisenlagen.
Annähernd 60 Gäste hörten an diesem Abend in der Urania zunächst einen sehr dichten Impulsvortrag von Thomas Leinkauf, Philosoph an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Autor des 2016 erschienenen Zweibänders „Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350–1600)“. Er stellte vier „Grundspannungen“ beziehungsweise „Irritationen“ dieser Epoche vor, eine davon diejenige von „Glauben und Unglauben“. Auf diese Weise wurde die Reformation – anders als zumeist von den Veranstaltern der Lutherdekade – historisch genau in einen breiteren Horizont eingelassen, ohne doch ihre besondere Bedeutung zu negieren. Aber: Ohne Humanismus keine Reformation.
Es folgte der Berliner Literatur- und Religionssoziologe Richard Faber mit seinem Vortrag „Gegen Personenkult, Reformationsmonopol und weltanschauliche Exklusivität“. Faber verwies auf den in Deutschland gern unterschlagenen „nationalen Charakter“ des Luthertums und plädierte für einen Blick auf Reformation und Protestantismus im Plural, dabei auch die für die Lutherdekade kennzeichnende Verengung auf die Person Luther kritisierend. Abschließend präsentierte er Vorschläge für entsprechend verbreitetere Reformationsfeierlichkeiten und ließ es sich auch nicht nehmen, eine Alternative zu Wittenberg als Pilgerziel vorzuschlagen: In das in der Nähe von Hamburg gelegene Friedrichstadt, „mitten im dreißigjährigen Krieg für Glaubensflüchtlinge verschiedenster Denominationen gegründet“.
Richard Fabers Vortrag ist in verschriftlichter Form, zusammen mit 13 anderen, abgedruckt im soeben erschienenen und auf der Veranstaltung frisch präsentierten Band 10 der Schriftenreihe der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg: „Vielfalt statt Reformation. Humanistische Beiträge zum Dialog der Weltanschauungen“, herausgegeben von Ralf Schöppner. Dort findet sich neben Aufsätzen zu Reformation und Lutherdekade noch mehr Lesenswertes zur Vielfalt von Lebensformen und zu humanistischer Integration, zu den Konfessionsfreien und zum Religions- und Weltanschauungsrecht, zum Reformationsjahr 2017, zu arabischem Freidenkertum und zum Humanismus im Islam. Mitgeschrieben haben Enno Rudolph, Wilhelm Schmid, Mouhanad Khorchide, Hubert Cancik, Frieder Otto Wolf, Carsten Frerk und viele andere.
Der Abschluss der Impulsreferate kam von Sarah Jäger, einer evangelischen Theologin mit dem Forschungsschwerpunkt Feministische Theologie, von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, kurz FEST, in Heidelberg. Sie machte „Individualisierung“, „Pluralisierung“ und das „Eröffnen neuer Räume“ als die zentralen Potenziale der Reformation geltend, ausdrücklich ohne sie exklusiv dem Protestantismus zuzuschreiben. In Hinblick auf das sogenannte Familienpapier der Evangelischen Kirche Deutschlands, das intern auf heftige Kritik – „Bibelferne“, „Abwertung der klassischen Familie“ – gestoßen war, stellt sie klar, dass man nicht die sozialen Verhältnisse biblischer Zeiten samt damit verbundener Bilder von Familie und Geschlecht auf die heutige Zeit übertragen dürfe: „Geschlecht ist keine Naturgegebenheit, sondern eine gesellschaftliche Konstruktion“.
Für Teile des Publikums waren naturgemäß die Abgrenzungen zu vergangenen und gegenwärtigen christlichen „Untaten“ nicht deutlich genug: Nicht diejenigen von Sarah Jäger zu den Auswirkungen christlicher Familientraditionen und nicht diejenigen von Thomas Leinkauf zu Luthers „Bauernverrat“. Die Frage, bis zu welchem Grad es sinnvoll ist, unsere heutigen ethischen Maßstäbe auf vergangene Epochen anzuwenden, wurde dank Wortmeldungen aus dem Publikum auf dem Podium sehr lebhaft diskutiert.
Angesichts von mehr als einer Million verkaufter Luther-Spielfiguren und anderer ebenfalls gut gehender Merchandising-Produkte wie Lutherbier oder Luthersocken vermag es nicht zu verwundern, dass eine Reihe prominenter evangelischer Theologen und Kirchenhistoriker in den letzten Jahren den dürftigen Inhalt und die mangelnde historische Tiefenschärfe dieser Kampagne kritisiert haben. Es muss stark angezweifelt werden, dass es den Veranstaltern der Lutherdekade gelungen ist, wirklich Interesse für das historische Ereignis, seine Bedeutung und seine Folgen zu wecken.
Die Veranstaltung in der Urania hat dies in bescheidenem Rahmen und in kritischer Absicht versucht. Insgesamt hätte man sich gewünscht, dass die Impulsreferate etwas kürzer gewesen wären und stattdessen das Gespräch der Vortragenden auf dem Podium länger: Denn alle drei hatten pointierte und kontroverse Standpunkte, die einem weiteren produktiven Schlagabtausch nicht im Wege gestanden hätten.
Xenia Alvarez

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein großer Schritt und möchte behutsam, achtsam und liebevoll gestaltet werden:
- Was möchten wir unseren Kindern mitgeben, damit sie neugierig, selbstbewusst und mitfühlend in die Schule und ins Leben aufbrechen?
- Und wie vermittelt man das am besten zeitgemäß?
Das waren die zentralen Fragen der vorabendlichen Runde am 21. Juni 2017, zu welcher der Humanistische Regionalverband Märkisch-Oderland, die Kita Verbindungsweg und die Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg interessierte Eltern, Erzieher*innen, Lebenskundelehrkräfte und Sozialarbeiter*innen aus der Region nach Fredersdorf einluden.
In einem kurzen Impuls betonte Konstanze Billeb, Leiterin der Humanistischen Fachschule für Sozialpädagogik, wie wichtig es im Kindergarten ist, Werte vorzuleben, Bindungen einzugehen und es den Kindern zu ermöglichen, spielerisch und selbstbestimmt die Welt entdecken zu lassen. Aus humanistischer Perspektive sei es besonders wichtig, den Kindern Freiräume zu lassen, selbst Werte aufzustellen, Regeln im Spiel selbst festlegen und neu erfinden zu lassen. Wenn die Kinder lernen, Wege für sich selbst zu finden, dann seien sie gut für den Übergang in die Schule gewappnet.
Die Lebenskundelehrerin Sylke Thonig knüpfte an dieser Stelle an und beschrieb mit vielen Beispielen, wie die Vermittlung von Werten im Lebenskundeunterricht an den Grundschulen weitergehe. Wichtig seien aus ihrer Sicht, dass die Kinder in der Schule lernen, Konflikte selbst zu lösen, Sachverhalte zu hinterfragen und mit Mut und Selbstvertrauen zu eigenen Entscheidungen zu finden.
In der Diskussion spielte vor allem die Frage eine Rolle, wie sich die Eltern mit ins Boot holen ließen und wie auf Kinder eingegangen werden kann, die für offene Konzepte nicht das Zutrauen haben. Auch die Vernetzung der Lebenskundelehrer*innen mit außerschulischen Einrichtungen der freien Jugendhilfe wurde angeregt. Im Anschluss hatten die Gäste noch Gelegenheit, eine kleine Lebenskunde-Ausstellung zu erkunden und das Gespräch im informellen Rahmen in den schönen Kitaräumen fortzusetzen.
Tina Bär
Veranstaltet vom Humanistischen Verband Deutschlands und vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, den Humanistischen Kindertagesstätten, der Humanismus Stiftung Berlin und dem Humanitischen Regionalverband Märkisch-Oderland.
Am 9. und 10. Oktober 2015 nahmen etwa 60 Gäste an der von der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg durchgeführten Tagung „Was gehört zu Deutschland? – Humanismus, Reformation und moderner Pluralismus“ im Ullsteinhaus in Berlin-Tempelhof teil. In den neuen Räumen der Humanistischen Fachschule für Sozialpädagogik sorgten die Referenten Mouhanad Khorchide, Micha Brumlik, Enno Rudolph, Hubert Cancik, Thomas Heinrichs, Horst Groschopp, Alexander Bischkopf, Tim Reiß und Ole Frahm sowie ein interessiertes Publikum für intellektuell anregende und lebhaft-kontroverse Debatten.
Was gehört zu Deutschland? Diese Frage meinte natürlich nicht in völkisch-ethnizistischer Weise „Was gehört zum deutschen Wesen oder zum deutschen Volk?“ und ebenso wenig „Was gehört exklusiv zu Deutschland und zu anderen Ländern nicht“? Sie meinte stattdessen: „Was gehört zu einem demokratischen Rechtsstaat, dessen verfassungsrechtliche Basis Menschen- und Bürgerrechte sind, und der darüber hinaus weltanschaulich neutral ist beziehungsweise es sein sollte?“
An den beiden Tagen wurde unter dieser übergeordneten Fragestellung thematisch einiges zusammengepackt: Ein humanistischer Blick auf Reformation und Lutherdekade, Potenziale und Grenzen des Religions- und Weltanschauungsrechts, Deutschland und der Islam.
Ein humanistischer Blick auf Reformation und Lutherdekade
2017 steht der 500. Jahrestag des lutherschen Thesenanschlags an. Schon seit 2008 wird diese Feier im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lutherdekade“ der Evangelischen Kirche Deutschland begleitet und vorbereitet. Liest man Publikationen der Lutherdekade, kann man sich eines Eindrucks nicht erwehren: Alles Gute kommt von Luther. Etwas weniger salopp: Freiheitsrechte, Demokratie, Toleranz und Pluralismus: All dies und vieles mehr haben wir, so scheint es, nur dem Wirken des Reformators zu verdanken.
Um die Reformation in einen breiteren historischen Kontext einzuordnen, ging der klassische Philologe und Humanismusforscher Hubert Cancik zurück in die griechische Antike und deren Rezeption zu Beginn der europäischen Renaissance. In seinem Vortrag „Der moderne Rechtsstaat und die Vielfalt der Lebensformen – Zur Rezeption antiker Staatslehren in der humanistischen Bewegung“ zeigte er, dass die wirkliche Arbeit an den geschichtlichen Quellen sehr viel kleinteiliger und vielschichtiger ist als jede Geschichtspolitik. Herodot, Thukydides, Platon und Aristoteles: Ein frühes politisches Nachdenken über Demokratie, Gleichheit, Autonomie und verschiedene Formen des Lebens; ein transpersonaler Staatsbegriff ohne mythisch-sakrale Elemente, verdeutlichend, dass eben nicht alle politischen Begriffe der Neuzeit ursprünglich religiöse Begriffe waren. Marsilius von Padua und Thomas Morus als frühe Rezipienten antiker Staatslehren in Europa: Bei ersterem die Trennung von geistiger und ziviler Gewalt, die eine Pluralität der Lebensformen ermöglicht; bei Morus die „Religion der Utopienser“ als Religionsfreiheit und die Ablehnung des Gedankens homogener Kulturen, der sich aktuell in so manchem europäischen Land einer neuen expliziten Beliebtheit erfreut. Kurzum, Hubert Cancik konstatierte eine gewisse „Modernität“ des politischen Denkens der Antike, ohne ihre kriegerischen Elemente und realdemokratischen Defizite auszublenden. Auf die Ausgangsfrage der Tagung „Was gehört zu Deutschland?“ wäre von hier aus zu antworten: Das humanistische, in der Renaissance wieder aufgenommene, Erbe der Antike. Kritisch diskutiert wurde im Anschluss, inwieweit das antike Denken von zum Beispiel Freiheit oder „Individualität“ mit unserem modernen Verständnis dieser Begriffe vergleichbar ist.
Der damit eingeschlagene Denk- und Forschungsweg wurde von Enno Rudolph, Philosoph, Theologe und Kulturwissenschaftler, weiter pointiert. In seinem Vortrag „Reformation statt Renaissance – Luthers Kampf gegen die humanistische Freiheit“ ging es nun nicht mehr nur um die These, dass es ohne den Humanismus in Antike und Renaissance gar keine Reformation und keinen Luther gegeben hätte. Rudolph legte vielmehr dar, dass der von Luther ausgehende deutsche Protestantismus ein Gegenhumanismus gewesen sei, der den Humanismus durch eine religiös kanalisierte Aufnahme entschärft und so demokratische und pluralistische Entwicklungen in Deutschland verzögert habe. Er zeigte dies an den aus Luthers Schriften herausgearbeiteten drei Oppositionen „Glaube statt Wissen“, „Gnade statt Freiheit“, „Schriftmonismus statt literarischer Pluralismus“. In den Heidelberger Disputationen, „das Dokument einer Verdammung der Philosophie und der Wissenschaft im Namen eines dezisionistischen religiösen Fundamentalismus“, vollziehe Luther eine "Zerstörung des Wissens". Die Schrift „Vom unfreien Willen“ („De servo arbitrio“) sei der „Zerstörung der Freiheit“ gewidmet, sich richtend gegen den roten Faden der Freiheitsideen in der Renaissance – von Petrarca über Pico della Mirandola bis hin zu Erasmus. Und beide Schriften im Ganzen atmeten den Geist der Intoleranz: Denn während im Humanismus die gesamte Literatur der griechischen, jüdischen, kleinasiatischen und lateinischen Antike als normatives Vorbild und Legitimation eines weltanschaulichen Pluralismus gilt, gibt es im Luthertum nur die eine wahre Schrift. Vor diesem Hintergrund wäre die gefeierte Reformation als eine Niederlage des Humanismus zu bewerten. Die Frage, ob Luther und die Reformation zu Deutschland gehören würden, beantwortete Rudolph empirisch mit Ja und bedauerte zugleich, dass dann der Humanismus eher nicht dazugehöre, „leider“.
Potenziale und Grenzen des Religions- und Weltanschauungsrechts
Diese etwas düstere Diagnose Rudolphs findet einen gewissen Widerhall im deutschen Religions- und Weltanschauungsrecht. Der Philosoph und Rechtsanwalt, Thomas Heinrichs, verwies in seinem Vortrag „Ein Recht für die Kirchen oder ein Recht für alle? – Wie offen ist das deutsche Religions- und Weltanschauungsrecht?“ vor allem auf dessen „Kirchenförmigkeit“.
Eröffnung durch Ralf Schöppner
Religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften wird gemäß Grundgesetz unter gewissen Voraussetzungen der privilegierte Status einer nicht-staatlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts zugebilligt, nämlich dann, wenn sie durch ihre Verfasstheit und die Zahl ihrer Mitglieder eine Gewähr der Dauer bieten. Diese Bedingungen erfüllen – nicht nur – aber vor allem die beiden christlichen Großkirchen: Eine, wenn auch abnehmende, so doch immer noch hohe Mitgliedschaft, mit klaren Regeln für Ein- und Austritt; Mitgliedsbeiträge; eine gewisse hierarchische Struktur. Wenn nun angesichts eines hiesigen Bevölkerungsanteils von mehr als einem Drittel konfessionsfreier Bürger und Bürgerinnen sowie der vielen hier lebenden Muslime auch humanistische und muslimische Organisationen ihr Recht auf Gleichbehandlung einfordern, dann wird – so Heinrichs – vor allem auch die Frage nach einer Zubilligung des Körperschaftsstatus aktuell. Dieser jedoch, sei für diese Organisationen weitaus schwerer zu erreichen, weil sie z. B. durch Formen von Zugehörigkeit ohne Mitgliedschaft und durch keine hierarchische Struktur geprägt (Humanistische Verbände) oder wie im Falle der Muslime dezentral in Vereinen und Moscheegemeinden organisiert seien, die nur etwa 10 bis 20 % der in Deutschland lebenden Muslime repräsentierten.
Die Tatsache, dass in einigen Bundesländern aufgrund von Gesetzen durch die Ministerien gebildete Beiräte als legitime Vertretung "der Muslime" in Deutschland angesehen werden, hält Heinrichs für verfassungswidrig. Er plädierte für eine dezentralisierte Prüfung und Vergabe von Körperschaftsrechten sowie die Anerkennung anderer Formen von Zugehörigkeit als nur expliziter Mitgliedschaft. In Bezug auf den Religionsunterricht merkte er an, diese in GG § 7 festgelegte Übertragung einer Pflichtaufgabe an die Religionsgemeinschaften – ethisch-moralische Erziehung – könne auch nichtreligiösen Weltanschauungsgemeinschaften übertragen werden. Auf die Frage der Tagung ließe sich mit Heinrichs also antworten: Zu Deutschland gehören Konfessionsfreie wie Muslime und entsprechend ihre juristische Gleichbehandlung.
Für eine Fortentwicklung und Korrektur des deutschen Staatskirchenrechts, das neuerdings gerne als "Religionsverfassungsrecht" bezeichnet wird, hatte sich in der Vergangenheit wiederholt auch der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik ausgesprochen, dabei ebenfalls beispielhaft auf Muslime und Konfessionsfreie verweisend.
Redebeitrag von Thomas Heinrichs
In seinem Vortrag "Öffentliches Wohl und Orientierung – Zur Zukunft der Religions- und Weltanschauungspolitik in Deutschland" fokussierte er diesmal jedoch stärker auf die Legitimität des bestehenden Staatskirchenrechts, das andernorts auch als "hinkende Trennung" von Staat und Kirche bezeichnet worden ist. Die Kooperation des Staates mit den Religionsgemeinschaften habe ihren guten Grund darin, dass sie fundamentalistische Strömungen und Tendenzen innerhalb dieser Gemeinschaften zurückdrängen und jede Reinheit der Lehre im Sinne staatsbürgerlicher Integration beeinträchtigen könne.
In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte Brumlik aber den Gedanken der Menschenwürde als einer Gemeinsamkeit von Humanisten/-innen und Religiösen. Auf den späteren Einwand aus dem Publikum, es gäbe weder im Alten noch im Neuen Testament irgendeine Formulierung von Menschenwürde, reagierte Brumlik mit einem Zitat aus dem Babylonischen Talmud. Zunächst aber plädierte er am konkreten Beispiel des verweigerten Handschlags eines Imans mit der rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner für eine sorgfältige Unterscheidung von Verletzung der Menschenwürde einerseits und Verstößen gegen etablierte Umgangsformen andererseits. Wer sich aus religiösen Gründen weigere, einer Frau die Hand zu geben, verstoße – so Brumlik – nicht gegen die Verfassung und beweise auch nicht seine "Integrationsunwilligkeit". Eher andersherum: Wer andere über die Kenntnis der Umgangssprache und Gesetzestreue hinaus zu irgendwelchen Konventionen zwingen will und dies als "Integration" preist, erweise sich als illiberal. Hier hätte sicherlich nachgefragt werden können, ob dieser Kommentar nicht die Bedeutung von kulturellen Konventionen und ethischen Prinzipien für das gesellschaftliche Zusammenleben unterschätzt.
Während also eine weite Auslegung der Religionsfreiheit für Brumlik "zu Deutschland gehört", war er deutlich skeptischer in Bezug auf die Frage, ob denn Humanismus eine Weltanschauung im Sinne des Grundgesetzes sei. Er attestierte einen Mangel an Ritualität z. B. der humanistischen JugendFeier (Brumlik sprach von "Jugendweihe") und sah den Humanismus eher als eine breite kulturelle Tradition denn als eine spezifische Weltanschauung.
Deutschland und der Islam
Inwiefern gehört der Islam zu Deutschland? Dass diese Frage in Politik und Öffentlichkeit heute überhaupt bejaht wird, bedeutet positiv den Abschied von der bundesrepublikanischen Lebenslüge, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Kritisch aber ist zu fragen: Wie sinnvoll ist die pauschale Rede von "dem Islam"? Gehört der Islam in allen seinen Formen und in jeder Hinsicht zu einem demokratischen Rechtsstaat und einer offenen Gesellschaft?
Mouhanad Khorchide, seit 2010 Professor für Islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für Islamische Theologie der Universität Münster, vertrat in seinem Vortrag "Humanismus und Islam" die These, dass ein auf einer humanistischen Koranhermeneutik basierender, gründlich reformierter Islam sogar eine notwendige Quelle auf dem Weg zur Verwirklichung eines globalen Humanismus sei.
Redebeitrag von Micha Brumlik
Grundlage dieser These war zum einen eine spezifische und in muslimischen Kreisen umstrittene – antiautoritäre – Lesart des Korans, in deren Zentrum das Bild eines barmherzigen Gottes steht, der den Menschen in seiner Individualität, Vernunft, Freiheit und Verantwortung bejaht. Zum anderen eine spezifische Lesart des Humanismus, die einer seiner Strömungen eine Sakralisierung des Menschen und damit verbundene absolute Wahrheitsansprüche diagnostiziert.
Khorchide kritisierte Menschen bevormundenden Ausprägungen von Religion und Humanismus mit der Begründung, dass Gott die absolute und unerkennbare Wahrheit sei und Menschen sie immer nur annähernd erkennen könnten. Man musste dieser theologischen Begründungsfigur gar nichts abgewinnen, um doch eine wesentliche Ähnlichkeit zum zeitgenössischen humanistischen Denken konstatieren zu können: Das skeptische und pluralistische Bewusstsein, eine unfertige Weltanschauung unter anderen ebensolchen ertragen zu müssen. Dass in der Humanistischen Akademie ein religiöser Gastredner ausgiebig über Gott sprechen kann, darüber was dieser Gott denke und wolle (ganz so als ob dessen Existenz überhaupt nicht in Frage stünde), ohne sich doch gleich lauten Unmut zuzuziehen, spricht vielleicht selbst schon für die Toleranz eines zeitgenössischen Humanismus, seine Akzeptanz einer doppelten Religionsfreiheit: Freiheit zur Religion und Freiheit von der Religion.
Khorchide bestimmte Humanismus als eine Haltung des Sich-Öffnens des Menschen nach innen und nach außen, hin zu Selbstreflexion und Gesellschaftskritik, zu Vernunft und Empathie, zu Kreativität und Verantwortung. Damit erwies er sich als ein so anregender wie wichtiger Gesprächspartner, nicht nur für humanistische Akademien und Verbände sondern auch für einen notwendigen gesellschaftlichen Dialog der Religionen und Weltanschauungen.
Die Teilnehmer-/innen hatten Gelegenheit, die Diskussionen in Arbeitsgruppen zu vertiefen und sich mit weiteren Aspekten des Tagungsthemas auseinanderzusetzen. Horst Groschopp, Kulturwissenschaftler und langjähriger Direktor der Humanistischen Akademie, leitete die AG "Der Beitrag des Pluralitätsdiskurses zum Untergang der Freidenkerbewegung"; Alexander Bischkopf, Bildungsreferent beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg diejenige zu "Verständnis für alles? – Zur Bedeutung des Pluralismus in humanistischer Pädagogik"; Tim Reiß, Philosoph und Germanist, sprach und diskutierte über "Was hält ein Land zusammen? – Homogenität oder Demokratie, Böckenförde oder Habermas?"; Ole Frahm thematisierte anhand vieler Beispiele "Was darf Karikatur?".
Trotz vielerlei Bemühungen hatte sich das geplante politische Abschlusspodium leider nicht realisieren lassen. Von einem ausgeprägten Interesse der politischen Parteien kann nicht berichtet werden. Unter Beibehaltung der Fragestellung "Kooperativer Laizismus nur für Religionen?" diskutierten Mouhanad Khorchide und Thomas Heinrichs mit Publikum und Moderator Sven Speer vom Forum für offene Religionspolitik.
Redebeitrag von Mouhanad Khorchide
Der Schwerpunkt der Diskussion lag zum einen auf der Frage, wie sich denn die grundgesetzlich gebotene Gleichbehandlung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften – hier: Islam und Humanismus – mit den christlichen Großkirchen verwirklichen lasse. Am Beispiel des Religionsunterrichtes wurde das Thema aber auch noch mal viel grundsätzlicher thematisiert: Warum überhaupt ein solcher Unterricht in einer staatlichen Schule? Aus dem Publikum kam der Einwand, dass doch gerade die muslimischen Kinder zu Hause schon genug davon hören würden und eher Ethik-Unterricht benötigten. Khorchide argumentierte, dass gerade weil viele Kinder zu Hause oftmals nur von einem reduzierten oder fälschlicherweise autoritär verstandenen Islam hören würden, bedürfe es des islamischen Religionsunterrichtes durch gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Hier war er sich mit Thomas Heinrichs einig, dass das Berliner Modell eines Sowohl-als-auch von Bekenntnis- und Ethik-Unterricht zukunftsfähig sei. Insgesamt wurde in der Diskussion aber der Bedarf deutlich, jenseits dieser rechtlich-politischen Fragen und angesichts der aktuellen Flucht- und Migrationsbewegungen auch mehr über die Chancen und Herausforderungen des kulturellen Miteinanders zu diskutieren.
Ralf Schöppner
Abschlussdiskussion
Videos: Frank Spade
In Kooperation mit der Humanistischen Akademie Deutschland, dem Humanistischen Verband DBerlin-Brandenburg, gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Eröffnung der ersten weltlichen Schule in Berlin fand am 28. und 29. Mai 2021 die Webtagung „100 Jahre weltliche Schule – Demokratiepädagogik damals und heute“, in Kooperation mit dem August Bebel Institut und dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR, statt.
Die Tagung stand im Kontext der gemeinsamen Feierlichkeiten der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, des Bezirksamts Neukölln – Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport sowie des Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg. Pandemiebedingt mussten die Veranstaltungen im vergangenen Jahr verschoben werden.
Am 15. Mai 1920 eröffnete die erste sogenannte bekenntnisfreie weltliche Schule in Berlin. Dort versammelten sich Kinder, deren Eltern sie vom Religionsunterricht abgemeldet hatten. Möglich geworden war dies durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919: die Beendigung der kirchlichen Schulaufsicht zugunsten einer rein staatlichen und das grundsätzliche Elternrecht zur Abmeldung in der Volkschule. Von diesem Recht wurde durchaus rege Gebrauch gemacht: 1921 gab es bereits 16 solcher Schulen in Berlin, 1930 dann 56, bevor sie allesamt von den Nationalsozialisten wieder geschlossen wurden. Hatten die weltlichen Schulen zu Beginn nur die Besonderheit, dass es an ihnen keinen Religionsunterricht und stattdessen bald einen nichtreligiösen „Moralunterricht“, zum Beispiel Lebenskunde, gab, entwickelten sich diese Schulen im Laufe des Jahrzehnts zu schulreformerischen Versuchsfeldern und zu einem Teil der reformpädagogischen Bewegung. Die meisten waren als sogenannte Lebensgemeinschaftsschulen anerkannt, als Versuchsvolksschulen mit antiautoritärer Erziehung.
Die Tagung wollte zweierlei in Erkundung bringen:
- Welchen Beitrag zur Verweltlichung des Schulwesens in Deutschland haben diese Schulen geleistet?
- Lassen sich in diesen Schulen erste demokratiepädagogische Bestrebungen ausmachen, die es erlauben, „damals“ und „heute“ in einen Kontinuitätszusammenhang zu stellen?
Demokratiepädagogik an weltlichen Schulen?
Der Kulturwissenschaftler und langjährige Präsident der Humanistischen Akademien, Horst Groschopp, bestritt vor über 50 Gästen den Einstieg in die Tagung. In seiner Keynote „Weltliche Schule und Lebenskunde“, gleichbetitelt wie sein im vorigen Jahr erschienenes Buch, schätzte er auf Basis seiner Quellen die demokratiepädagogische Relevanz der weltlichen Schulen als sehr gering ein. Die Schulen hätten sich abgesehen von einem staatlichen Moralunterricht nicht von anderen Schulen unterschieden, wobei er hier die Lebensgemeinschaftsschulen terminologisch ausschloss.
Ihren politischen und pädagogischen Befürworter*innen sei es primär um einen gemeinsamen Ethikunterricht und Religionsersatz gegangen, weniger um Demokratieförderung. Bei der Entfernung des Religionsunterrichtes sei es auch nicht um einen Pluralismus der Anschauungen gegangen, sondern um verbindlich Säkulares. Die Herkunft des heute in Berlin und Brandenburg erteilten fakultativen, weltanschaulichen Unterrichtsfach Humanistische Lebenskunde liege demnach eher im nichtstaatlichen Unterricht der freireligiösen Gemeinden.
Zu guter Letzt stellt Groschopp auch noch heraus, dass im Umfeld der weltlichen Schulen so gut wie gar keine Rede von Humanismus war; pointiert erklärend, das damals vorherrschende, eher bürgerlich-konservative Verständnis von Humanismus sei wenig kompatibel gewesen mit einer aus Sicht von KPD und SPD notwendigen Erziehung zum Klassenkampf.
Keynote von Horst Groschopp
Experimente und Reformansätze
Damit war eine ausgezeichnete Basis für Widerspruch und Kontroverse gelegt. Die Referent*innen der vier folgenden Workshops kamen zu einer tendenziell anderen Einschätzung.
Nele Güntheroth, die über die weltlichen Schulen promoviert hat, aktuell Kuratorin für Stadt und Museum beim Stadtmuseum Berlin, zeigte anhand von Zeitzeugenberichten, Dokumenten und Fotos, dass der Unterricht an den weltlichen Schulen und den sich daraus entwickelnden Lebensgemeinschaftsschulen insgesamt lebensnaher, schüler- und problemorientierter war als an den meisten anderen staatlichen Schulen der damaligen Zeit. Es habe sich nicht nur um Schulen ohne Religionsunterricht gehandelt, sondern um „Experimentierfelder für Reformansätze“. Sie entfaltete ein breites Spektrum an organisatorischen, inhaltlichen und methodischen Beispielen: offenere Sitzordnungen, Arbeit in AGs – auch musisch, zum Beispiel Theater – Projektarbeit zum sozialen Lernen, „internationale“ Themen wie „Esperanto“ oder „Italien“, Entwicklung eigener Schulbücher mit sozialen Themen, Schulfahrten, festliche Elternabende mit Beiträgen der Kinder. Es habe dort ein von anderen Schulen abweichendes ganzheitliches, koedukatives Bildungsideal vorgeherrscht; die Persönlichkeitsbildung der Kinder und ihre Unterstützung bei der individuellen Berufsfindung haben im Vordergrund gestanden.
Auch der Historiker Eckhard Müller stellte in seinem Workshop zu den weltlichen Schulen in der preußischen Provinz Brandenburg deren besonderes Augenmerk auf positive Gemeinschaftserlebnisse, etwa durch Schülerparlamente und gemeinsame Fahrten, und Pazifismus wie in der Ausstellung „Krieg dem Kriege“ heraus. Müller legte dar, dass weltliche Schulen beziehungsweise sogenannte Versuchsschulen besonders an Industriestandorten gegründet wurden und konzentrierte sich in seinen Ausführungen besonders auf Frankfurt/Oder, Finsterwalde, Luckenwalde und Wittenberge.
„Du wirst gebraucht“: So fasste Richard Rogler, langjähriger Hauptschul- und Museumslehrer, die Haltung der Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen und Schülern an weltlichen Schulen zusammen, unter besonderer Hervorhebung des Wirkens der beiden Neuköllner Erzieher Wilhelm Wittbrodt und Alfred Lewinnek.
Das war auch der Tenor im Workshop zur „Geschichte und Unterrichtskonzepte der weltlichen Schulen in Halle/Saale“, der von Viola Schubert-Lehnhardt, Vizepräsidentin der Humanistischen Akademie Deutschland, und Edmund Fröse vom Humanistischen Regionalverband Halle-Saalkreis e. V. geleitet wurde. Allerdings merkte die auch zu Frauen- und Geschlechterfragen forschende Dozentin Schubert-Lehnhardt kritisch an, dass es recht „kühn“ sei, mit unseren heutigen Maßstäben von Demokratie und Demokratieerziehung eine Kontinuitätslinie zum Schulunterricht der 1920er-Jahre in Deutschland zu ziehen – einer Zeit der nur zaghaften Demokratisierung, die auf erbitterten und breiten antidemokratischen Widerstand traf.
Insgesamt wurde am ersten Tag deutlich, dass die Akteur*innen der weltlichen Schule wichtige pädagogische und politische Pionierarbeit geleistet haben, die von der historischen Schul- und Unterrichtsforschung zu wenig gewürdigt wird. Betrachtet man eher die politisch-konzeptionelle Ebene und nur der weltlichen Schulen, so findet man anscheinend wenig Hinweise auf demokratiepädagogisches Engagement in den Verlautbarungen verantwortlicher Politiker*innen und Wortführer*innen. Schaut man hingegen direkt in das Unterrichtsgeschehen und bezieht die Lebensgemeinschaftsschulen mit ein, dann findet man in den täglichen pädagogischen Mikrokosmen vielfältige Formen sozialen Lernens und des Einübens in das Leben einer Gemeinschaft der Gleichen. Man kann dieses Engagement im historischen Rückblick wertschätzen, ohne die These von der „Demokratiepädagogik damals“ zu überziehen und die Gesamtbedeutung in einer Gesellschaft zu überschätzen, die sich auf die demokratische Wahl Hitlers zubewegte.
Demokratie als Lebensform
Auf der Tagesordnung für den nächsten Tag stand folglich die Frage, was genau denn mit Demokratiepädagogik heute eigentlich gemeint ist. Vor dem Hintergrund eines Konzeptes von „Demokratie als Lebensform“ lässt sich das Experimentierfeld weltliche Schule mit seinen verschiedenen Formen gleichberechtigten sozialen Lernens durchaus als wichtige Vorbedingung oder Element demokratischen Lernens verstehen.
Mit den Vorträgen von Bianca Stern, Lebenskundelehrerin beim Humanistischen Verband, und Angelika Eikel, Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, bekam die Rede von Demokratie und Demokratiepädagogik – damals und heute – eine theoretische Grundierung. Dabei bezogen sich beide auf den US-amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey (1859–1952): Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sondern bedarf geteilter Erfahrungen in der Lebenswelt: Ein Gramm Erfahrung wiegt mehr als eine Tonne Theorie. Geteilte Erfahrung aber ist keine harmonische Idylle: Stern geht es bei der Umsetzung demokratischer Werte im Unterricht vor allem auch um das Austragen von Konflikten und eine Stärkung der Konfliktfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Sie arbeitet mit der Betzavta-Methodik des Jerusalemer ADAM-Instituts für Demokratie und Frieden. Entscheidend sei die Haltung und Persönlichkeit der Lehrenden: Es gibt keine Demokratie ohne überzeugte und streitbare Demokrat*innen. Angelika Eikel richtete ihren Fokus auf die Frage, warum menschenfeindliches Gedankengut gerade auch bei Kindern und Jugendlichen stark zunehme, so neuere Studien. Sie problematisierte in diesem Zusammenhang auch die psychosozialen Folgen von längeren Grundrechtseinschränkungen in diesen Altersgruppen und forderte Partizipation als ein Recht und Ziel in Schulen, um das demokratische Zusammenleben in kulturell und religiös heterogenen Gruppen zu üben: Um Diversität anerkennen zu können, müsse sie auch aktiv im Alltag erfahren und gelebt werden.
Mit Demokratiepädagogik gegen Höcke, Halle und Hanau?
Die abschließende Podiumsdiskussion, moderiert von Karen Taylor von Each One Teach One, kurz EOTO, war der Frage nach den Potenzialen und Grenzen von Demokratiepädagogik angesichts von Rechtspopulismus, Rassismus und Antisemitismus gewidmet. Frauke Edda Groner, die im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf als Politische Bildnerin arbeitet, legte den Finger in die Wunde: Wenn es keinen politischen Willen gebe, die Schulen in Deutschland zu reformieren und insbesondere stärker für andere gesellschaftliche Akteur*innen zu öffnen, dann nützen die besten demokratiepädagogischen Ideen nichts. Dies ist ein Beispiel für die allgemeinere und strukturelle Kritik, die auch stets an Deweys Konzepte herangetragen worden ist: Eine anspruchsvolle pädagogische Programmatik braucht für ihre Realisierung entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen, deren Schaffung selbst auch Teil der Programmatik sein müsste und nicht ausgeblendet werden darf.
Auch die anderen Gäste auf dem Podium, Moussa Al-Hassan Diaw von der Universität Münster, der Antisemitismusforscher Steffen Klävers vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus und die Bildungsreferentin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend Maike Axenkopf problematisierten auf unterschiedliche Weise die Frage des Zugangs zu Menschen, die für demokratieferne und menschenfeindliche Ansichten empfänglich sind – oder gar schon durch ideologisch verfestigte Haltungen auffallen. Während Steffen Klävers insbesondere die Potentiale von „klassischer Aufklärung“ hervorhob, verwies Moussa Al-Hassan Diaw auf seine Erfahrungen im Bereich Extremismusprävention, die ihn gelehrt haben, dass man allein mit „harten Fakten“ nicht jeden Menschen erreicht. Die Auseinandersetzung laufe hier auch über die emotionale Ansprache und ein Interesse an der psychosozialen Verfasstheit von Personen mit menschen- oder demokratiefeindlichen Ansichten. Maike Axenkopf hob als Vorteil von theater- und erlebnispädagogisch ausgerichteter Jugendarbeit hervor, dass darüber ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedensten Voraussetzungen erreicht werden, weil für derart motivierte Begegnungen keine speziellen Sprachkenntnisse oder kulturelles Spezialwissen nötig seien.
Diskutiert wurde auch die Frage nach ideologischen Verfestigungen in Berufsgruppen mit besonderer gesellschaftlicher Verantwortung. Dass Polizei- und Sicherheitsbehörden hier ein Problem haben, ist hinlänglich bekannt – neu dürfte hingegen für einige Tagungsbesucher_innen Diaws Beobachtung gewesen sein, dass es auch bei Sozialarbeiter*innen ideologische Einstellungen gebe, die den kritischen Blick auf extremistische Phänomene und Personen verstellen beziehungsweise verklären. Beispielsweise werden legalistische Islamist*innen nicht als solche, sondern als Verbündete in angeblich antirassistischen/antikolonialen/humanistischen Anliegen wahrgenommen oder verklärt, obwohl sie in Wahrheit antisemitische und antidemokratische Weltanschauungen vertreten.
Einmal mehr mit von der Partie der Dauerbrenner: „Was ist so schlimm daran, jemanden nach seiner Herkunft zu fragen, von dem ich vermute, er oder seine Familie hat irgendeinen Migrationshintergrund?“ So richtig zufriedenstellend konnte diese Frage aus dem Publikum vom Podium nicht beantwortet werden. Der herangezogene Vergleich, man frage einen übergewichtigen Menschen ja auch nicht gleich nach seiner Diät oder spreche eine großohrige Person auch nicht gleich auf seine Ohren an, war zwar amüsant, schien aber wenig Überzeugungskraft zu entfalten. Bei diesem Thema gibt es offensichtlich noch einigen Bedarf an kleinteiliger und genauer Auseinandersetzung über die Motive der Fragenden und die Empfindungen von Befragten.
Sehr ermunternd war an diesem Podium insgesamt der Haupteindruck, dass sich die Gäste mit ihren diversen weltanschaulichen, religiösen und kulturellen Hintergründen nicht nur in vielerlei Hinsicht einig waren, wo die Schuhe drücken, sondern vor allem auch Interesse signalisierten, bei diesem Thema in Zukunft noch mehr zusammenzuarbeiten. Anders wird es auch nicht gehen.
Die Beiträge und Ergebnisse der beiden Tage werden im nächsten Jahr in der Schriftenreihe der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg publiziert.

Über die Akademie
Lernen Sie das Profil der Humanistischen Akademie genauer kennen: Klicken Sie bitte auf den Button.
Was Sie noch interessieren könnte
Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg
Adresse
Wallstraße 65
10179 Berlin
Kontakt
- Telefon:030 31 98 86 437
- E-Mail:info@humanistische-akademie-bb.de
- Gehe zur Website:www.humanistische-akademie-bb.de