
Humanistische Porträts
Auf dieser Seite wird Ihnen die Publikationsreihe „Humanistische Porträts“ der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg präsentiert – jeder Band mit Text und Bild. Bislang sind zwölf Bände erschienen. Sie können jeden Band bestellen.
An wen wird mit den Porträts erinnert?
In den Humanistischen Porträts erinnern wir an Menschen,
- die durch ihr Leben, ihr Reden, Schreiben und Handeln „Menschlichkeit“, „Bildung und Barmherzigkeit“ bewiesen und den Menschen „in die Mitte“ gestellt haben
- die sich aus keinem anderen Grund für ihre Mitmenschen, für Menschenrechte und Menschenwürde eingesetzt haben, als weil sie Menschen sind: „der Mensch als Mensch“ (Cicero)
- die Ehrfurcht vor der Natur und jeglichem Leben hatten
- die „Bildung“ nicht als Privileg, als Etikett für Eliten oder als Mittel zum Ausschluss benutzten und humanitäre Praxis („Barmherzigkeit“) nicht als Mittel zur bloßen Linderung oder Verdeckung von Missständen, Ausbeutung und Repression
- die dadurch gezeigt haben, dass Humanismus ohne Humanität nicht zu machen ist
Was bestimmt die Auswahl der Porträts?
Die oben beschriebenen Menschen gab und gibt es unter verschiedenen Namen, in allen Epochen und Regionen, in allen Klassen, Schichten, Geschlechtern und Berufen. Ausdrücklich „Humanist*innen“, italienisch: umanista, heißen sie seit der italienischen Renaissance (15. Jahrhundert). Die Namen „Humanismus“, „Humanitarismus“ oder „humanistische Bewegung“ sind Prägungen der westeuropäischen Moderne (19. bis 20. Jahrhundert). Das Grundwort „humanitas“, übersetzt: „Menschheit“, „Menschlichkeit“) ist römische Prägung des ersten Jahrhunderts v. u. Z.
Die „humanistische Perspektive“ bestimmt die Auswahl der Porträts, den „Sehepunkt“ und den Fokus der Darstellung:
- Ein Porträt ist keine Biographie, keine umfassende, gleichmäßig ausführliche Erzählung aller Stationen des Lebens einer*s Einzelnen.
- Ein humanistisches Porträt ist keine Hagiographie, schafft keine Galerie von Vorbildern, keine Heldenschau, sondern ist anschauliche Charakteristik und kritisch.
- Es zeigt auch Irrwege und Missbrauch, Scheitern und Fehlentwicklung. Die Person, der „ganze Mensch“, seine Lebenspraxis und sein Werk, die vielfältigen weltanschaulichen Mischformen und die individuellen Synthesen bilden die Mitte eines humanistischen Porträts.
Die Herausgeber:
- Hubert Cancik, Dr. Dr. h. c., Prof. i. R., Arbeitsgebiete: Klassische Philologie, Antike Religionsgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Humanismus-Forschung
- Ralf Schöppner, Dr., Philosoph, Politik- und Literaturwissenschaftler, Geschäftsführer der Humanistischen Akademien Berlin-Brandenburg und Deutschland, Schwerpunkt: Humanistische Ethik
- Olaf Schlunke, Historiker, Archäologe und Archivar, Leiter des Kulturhistorischen Archivs des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg, Schwerpunkt: Humanismus- und Wissenschaftsgechichte
Einen Überblick zu den Porträts bekommen Sie im folgenden Verlagsflyer:
Hier können Sie sich über jeden bis dato erschienenen Band der Reihe „Humanistische Porträts“ der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg näher informieren – klicken Sie einfach auf die Überschrift:
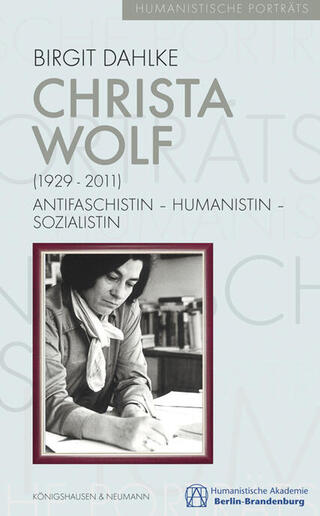
- Autorin: Birgit Dahlke
- erschienen 2019 bei Königshausen & Neumann
- 96 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-6822-5
- 9,80 Euro
Die Literatur Christa Wolfs hat Folgen. Von Beginn an polarisierte jeder ihrer Prosatexte die Leser*innenschaft, egal ob Nachdenken über Christa T. (1968), Kindheitsmuster (1976), Kein Ort. Nirgends (1979), Kassandra (1983), Medea. Stimmen (1996) oder der letzte Roman Stadt der Engel (2010). Die Mehrheit ihrer Bücher erschien in Ost und West zugleich, wurde jedoch in beiden Deutschlands unterschiedlich gelesen. Das Porträt zeigt, wie Krieg und Flucht als biographische Schlüsselerfahrung das Selbstverständnis der 1929 in Landsberg an der Warthe geborenen Autorin bestimmen und ihren ästhetischen Ausdruck in einer ‚Poetik der Schuld‘ finden. Hat die frühe protestantische Erziehung einen Anteil daran? Gefragt wird nicht nur nach dem expliziten Beitrag einer Schriftstellerin zum deutsch-deutschen Humanismus-Diskurs, sondern vor allem danach, auf welche Weise humanistische Werte die literarische Form ihrer Prosa und Essayistik über fünf Jahrzehnte hin prägen. Wie funktionierte eine auf individuelle wie gesellschaftliche Verantwortung zielende Poetik der „subjektiven Authentizität“ innerhalb des DDR-Sozialismus? Trägt ein solches Konzept nach 1989? Welche literarisch innovativen Formate bringt es hervor?
Über die Autorin:
Die Literaturwissenschaftlerin Birgit Dahlke publizierte unter anderem die Monografien Wolfgang Hilbig (2011), Jünglinge der Moderne (2006) und Papierboot (1997).
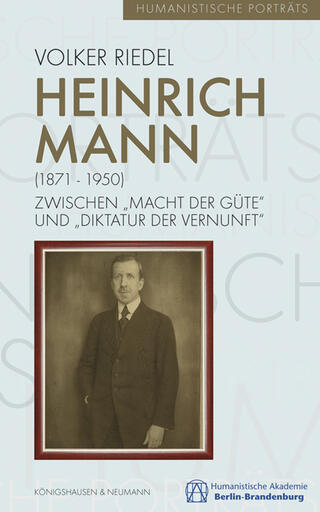
- Autor: Volker Riedel
- erschienen 2019 bei Königshausen & Neumann
- 80 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-6885-0
- 9,80 Euro
Heinrich Manns (1871–1950) literarisches und publizistisches Werk ist zutiefst von humanistischen Impulsen geprägt. Humanität steht für ihn in enger Verbindung zu Vernunft, Güte, Demokratie, Freiheit, Wahrheit und Frieden, und sie hat einen ausgesprochen kämpferischen Charakter (bis hin zur Forderung nach einer „Diktatur der Vernunft“). Der Schriftsteller war ein scharfer Kritiker des Kaiserreichs und wurde zu einem geistigen Repräsentanten der Weimarer Republik, zugleich aber auch zu einem Ankläger ihrer Schwächen. Er verabscheute die Nazibewegung seit ihren Anfängen und ging bereits im Februar 1933 ins Exil (Frankreich, 1940 USA). Seine Polemik gegen eine vom Großkapital dominierte Gesellschaft führte ihn zunehmend zu einer (wenn auch nicht unkritischen) Annäherung an sozialistische Positionen. Das Buch konzentriert sich auf jene Phasen seiner Entwicklung und auf jene Werke, in denen das Thema der Menschlichkeit ausdrücklich im Vordergrund stand: etwa auf das Schauspiel „Madame Legros“ aus dem Vorfeld der Französischen Revolution und auf die Romane über Heinrich IV. als ein Vorbild für die „Macht der Güte“. Dabei werden problematische und tragische Seiten seiner Humanismuskonzeption keineswegs ausgeklammert, gleichermaßen ihre Ideale wie ihre Illusionen aufgezeigt.
Über den Autor:
Volker Riedel, 1970 Promotion, 1982 Habilitation. 1968 bis 1987 Mitarbeiter an der Akademie der Künste zu Berlin, 1987 bis 2009 Professor für Klassische Philologie an der Universität Jena. Forschungen zur Antikerezeption und zur deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Editionen und Publikationen zu Heinrich Mann.
Eine Rezension von Walter Delabar, erschienen in: „Germanistik 61“ (2020). Heft 1/2, S. 424–25) finden Sie nachfolgend.

- Autor: Uwe Plath
- erschienen 2020 bei Königshausen & Neumann
- 92 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-6982-6
- 9,80 Euro
Sebastian Castellio war ein Mann vom Geiste des Erasmus, Humanist, Moralist, Philologe, Theologe und Pädagoge. Seine lateinische Bibel und seine „Heiligen Dialoge“ (Dialogi Sacri) wurden in ganz Europa bis zur Zeit der Aufklärung für den Latein- und Religionsunterricht verwendet. Für uns heute ist Castellio vor allem durch seine Kontroverse für Toleranz interessant, die er nach der Verhaftung und Verbrennung des Spaniers Michael Servet in Genf gegen Johannes Calvin und Theodor Beza führte. Trotz Stefan Zweigs bekanntem Roman „Castellio gegen Calvin. Ein Gewissen gegen die Gewalt“ ist der Basler Humanist in Deutschland noch weithin unbekannt. Das liegt vor allem daran, dass die meisten seiner Schriften nicht zu seinen Lebzeiten, sondern erst postum veröffentlicht werden konnten. Erst seit wenigen Jahren liegen auch deutsche Übersetzungen seiner Toleranzschriften vor, die seine Aktualität und Bedeutung für die Toleranzdiskussion beweisen. Sein im Jahre 1554 gegen Calvin gerichteter Satz „Einen Menschen töten heißt nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.“ hat bis heute nichts an Überzeugungskraft eingebüßt.
Über den Autor:
Dr. Uwe Plath studierte Geschichte, Latein, evangelische Theologie; 1972 Promotion bei W. Kaegi über Calvin und Basel (Basel/Zürich 1974: Der Fall Servet, Essen 2014). Er hat sich durch zahlreiche Studien, durch Übersetzungen und die Edition des Contra libellum Calvini als Kenner Castellios ausgewiesen.
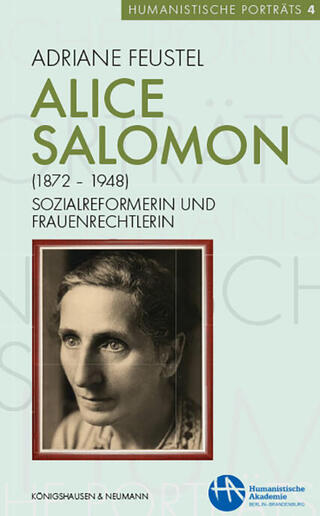
- Autorin: Adriane Feustel
- erschienen 2020 bei Königshausen & Neumann
- 80 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-6886-7
- 9,80 Euro
„To make the world a better place to live in“ war das Motto, unter das Alice Salomon (1872 Berlin–1948 New York) ihr praktisches und theoretisches Tun stellte. Das Porträt zeigt Alice Salomon als faszinierende Persönlichkeit und als eine der herausragenden deutschen Sozialreformerinnen und Feministinnen des 20. Jahrhunderts. Es vermittelt Grundzüge ihres Werkes im Zusammenhang ihrer Lebensgeschichte und im Kontext der sozialen Auseinandersetzungen und Emanzipationsbewegungen ihrer Zeit. Es zeigt, wie aus dem jungen Mädchen aus bürgerlichem Elternhaus, dem jedwede Ausbildung versagt war, die Sozialreformerin und Frauenrechtlerin, die Nationalökonomin und Schulgründerin, die Pazifistin und Internationalistin wurde, die soziale Arbeit in Theorie und Praxis als Beitrag zur Verwirklichung einer sozial gerechten, mit den Hilfebedürftigen solidarischen Gesellschaft konzipierte.
Vor dem Hintergrund ihrer Vertreibung durch die Nationalsozialisten und der jahrzehntelangen Verdrängung aus dem öffentlichen Bewusstsein wird Alice Salomon als Vordenkerin einer sozialen humanen Gesellschaft gewürdigt. Ihre unorthodoxen Denk- und Handlungsweisen, ihre zwischen Gegensätzen vermittelnde Haltung und ihr Respekt vor dem Anderen, dem Fremden sind von inspirierender Aktualität.
Über die Autorin:
Dr. Adriane Feustel, Jg. 1943, Historikerin, Gründerin und bis 2013 Leiterin des Alice Salomon Archivs der Alice Salomon Hochschule Berlin. Editorin einer umfangreichen historisch kritischen Neuauflage der Schriften Alice Salomons; Forschungen zu Sozial- und Frauengeschichte des 19./20. Jahrhunderts.
Zu diesem Band sind Rezensionen in der Zeitschrift „Die Soziale Arbeit“, kurz DZI, in der Feministischen Rezensionszeitschrift „Weiberdiwan“ (Herbst 2020) und in der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, kurz ZfG, erschienen.
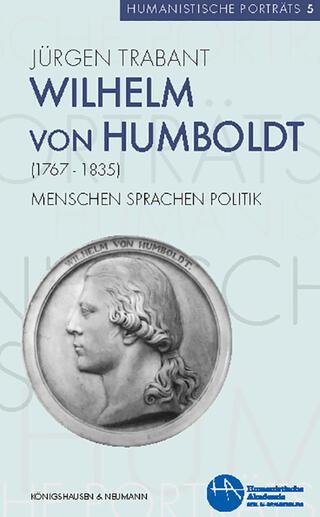
- Autor: Jürgen Trabant
- erschienen 2020 bei Königshausen & Neumann
- 110 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-7149-2
- 9,80 Euro
Wilhelm von Humboldt (1767–1835) war Denker und Politiker. Eine tiefe Liebe zum Griechischen und das Wissen um die schöpferischen Kräfte der Geschlechtlichkeit liegen seinem Denken und Handeln zugrunde. Den Zweck des Menschen bestimmt er als „proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen“. Diese höchste Bildung des Menschen hat er persönlich, wissenschaftlich und politisch in vielfacher Hinsicht verfolgt. Er richtet sein geistiges Interesse auf Anthropologie als Wissenschaft von den mannigfaltigen Erscheinungsweisen des Menschen. In der Sprache findet er das Zentrum des Anthropos. Sprache ist „Arbeit des Geistes“, also primär Denken, das sich in den verschiedenen „Weltansichten“ der Sprachen manifestiert. Forschungen zu zahlreichen Sprachen der Welt führen zu seiner Philosophie der Sprache und einer neuen, kognitiv ausgerichteten vergleichenden Sprachwissenschaft. Aufs engste verbunden mit dem an Bildung und Sprache orientierten Denken ist Humboldts politisches Handeln, wenn er das preußische Erziehungssystem reformiert, die Berliner Universität gründet und die Einrichtung des Königlichen Museums maßgeblich bestimmt. Die föderale Neuordnung Deutschlands und die Einführung einer Verfassung in Preußen sind ihm nicht gelungen.
Über den Autor:
Jürgen Trabant war Professor für Romanistik an der FU Berlin und für Europäische Mehrsprachigkeit an der JU Bremen. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Semiotik, Sprachpolitik, Geschichte der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie, insbesondere Giambattista Vico und Wilhelm von Humboldt.
Zu diesem Band ist eine Rezension von Heinz-Elmar Tenorth in der „Erziehungswissenschaftlichen Revue“, kurz EWR, erschienen.
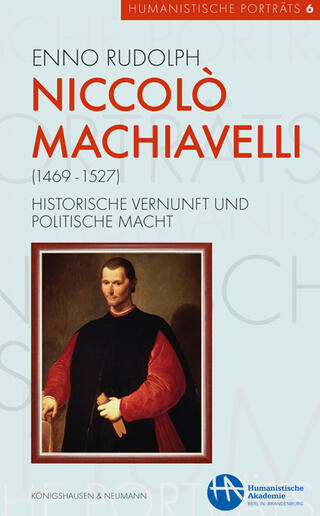
- Autor: Enno Rudolph
- erschienen 2021 bei Königshausen & Neumann
- 82 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN 978-3-8260-6730-3
- 9,80 Euro
Niccolò Machiavellis Ruhm beruht im Wesentlichen auf dem Erfolg seiner wenig umfangreichen und in der Form eines Briefes an Lorenzo di Piero de Medici (Enkel Lorenzos des Prächtigen) im Jahre 1513 im Exil verfassten und 1532 postum erschienenen Schrift „Der Fürst“ („Il Principe“). Die über lange Zeit isoliert vom Werkkontext verlaufene Rezeption dieses Büchleins hat die Entstehung des verbreiteten Urteils begünstigt, demzufolge Machiavelli als der Begründer des nach ihm benannten „Machiavellismus“ gilt. Diese Ansicht kann inzwischen als überholt angesehen werden, nachdem die weltweite Rezeption seines Werkes seit Jahrzehnten zunehmend intensiver den Kontext seiner anderen Schriften mitberücksichtigt hat. Die Zuordnung Machiavellis zur Strömung des Humanismus rechtfertigt sich unter anderem aus seiner deutlichen Prägung durch die klassischen Bildungsideale der „humanistischen Studien“ (studia humanitatis), die sich im Erwerb von Kompetenzen wie der Kunst der Geschichtsschreibung, der Rhetorik oder der kreativen Betätigung auf dem Feld der Poesie manifestiert haben. Sämtliche dieser Kompetenzen hat Machiavelli sich im Rahmen seiner permanenten Auseinandersetzung mit eminenten Autoren der Antike – vornehmlich der römischen – angeeignet. Ihm kommt zudem das Verdienst zu, das humanistische Paradigma um die Dimension der Kunst des politischen Handelns erweitert und die Politik zu einem Praxisfeld sui generis gemacht zu haben.
Über den Autor:
Enno Rudolph, Emeritus für Philosophie an der Universität Luzern. 1974 Promotion über Kant an der Universität Heidelberg. 1983 Habilitation über Aristoteles daselbst. Gründer und bis 2011 Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts. Gastprofessuren im In- und Ausland. Zahlreiche Veröffentlichungen vor allem zur Philosophie der Renaissance.
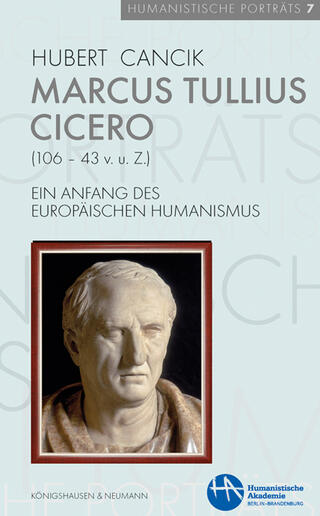
- Autor: Hubert Cancik
- erschienen 2021 bei Königshausen & Neumann
- 70 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-6870-6
- 9,80 Euro
Marcus Tullius Cicero war „der erste Humanist“, schreibt Stefan Zweig (1940). Warum der erste, warum gerade damals, was bedeutet „Humanist“ im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit, eineinhalb Jahrtausende vor der Erfindung des Berufsnamens „umanista“? Cicero ist ein „neuer Mann“ („homo novus“), ein Aufsteiger, ein engagierter Anwalt, vorbildlicher Beamter, der letzte Verfechter der Adelsrepublik und ihrer Freiheit. Er ist erklärter Zivilist, kein Pazifist; er verteidigt römischen Imperialismus, Kolonialismus, Sklaverei. Cicero ist Philhellene, Philosoph und Politiker, bekennender Anhänger der skeptischen Akademie, ein Zweifler aus Prinzip. Aber er vertritt die stoischen Lehren von Natur und Vernunft. Der Begriff „humanitas“ – „Humanität, Menschheit, Menschlichkeit, Menschsein“ wird in Ciceros Reden, philosophischen Dialogen und Briefen sehr häufig gebraucht. „Humanität“ ist bestimmt durch „Mitgefühl, Barmherzigkeit, Milde“; sie steht gegen „Grausamkeit“ und „Rohheit“. Deswegen ist „Entrohung“ und „Bildung“ wichtigste Aufgabe der menschlichen Sozietät. Mit seinem Diskurs „Humanität“, Natur und Vernunft, Entrohung und Barmherzigkeit, Republik und Freiheit setzt Cicero in dem gewalttätigen, von Ungleichheit und Repression gezeichneten letzten Jahrhundert der römischen Republik einen Anfang des europäischen Humanismus. Es ist nur ein Anfang, es gibt noch andere Ansätze, und es gibt Fortschritte der humanistischen Bewegung. Aber, so sagt man, „der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“.
Über den Autor:
Hubert Cancik ist emeritierter Professor für Klassische Philologie und Religionshistoriker an der Universität Tübingen.
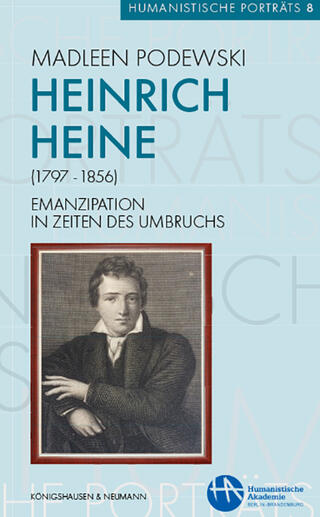
- Autorin: Madleen Podewski
- erschienen 2021 bei Königshausen & Neumann
- 94 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-7071-6
- 9,80 Euro
Heinrich Heines Humanismus hat viele, sich zum Teil widersprechende Dimensionen. Aber gerade in dieser Vielschichtigkeit ist er zutiefst verbunden mit den gravierenden Umbrüchen, die die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts prägen: Mit dem Ende der Goethezeit verlieren Vorstellungen ihre Plausibilität, die von der Epochenschwelle um 1800 herkommen: vom „ganzen Menschen“, von der Geschichte als Fortschritt und von der Rolle, die Kunst und Dichtung für die „Erziehung des Menschengeschlechts“ spielen können. In einer Übergangsphase, in der dieses Alte seine Verbindlichkeit verliert und in der um das Neue noch gestritten wird, engagiert sich Heine für eine humane Welt. Dabei versteht er sich selbst emphatisch als Zeitgenosse, dem „der große Weltriss mitten durch das Herz geht“. Der Band zeigt, welche vielfältigen Vorschläge Heine dafür unterbreitet, wie die Geschichte der Menschen neu gesehen und gestaltet werden kann – in einer Haltung des Experimentierens und in der ihm eigenen, unnachahmlichen Diktion zwischen Betroffenheit und spöttischer Distanz. Und er zeigt, wie Heine, als getaufter Jude und Exilant in Paris ein Außenseiter, dabei immer und trotz aller scharfen Kritik an den Zeitläuften voller Empathie für die leidende Menschheit ist.
Über die Autorin:
Madleen Podewski hat Germanistik und Italianistik studiert. Nach Lehr- und Forschungstätigkeiten in Karlsruhe, Jerusalem, Wuppertal, Aachen und Marburg ist sie jetzt Privatdozentin an der Freien Universität Berlin.
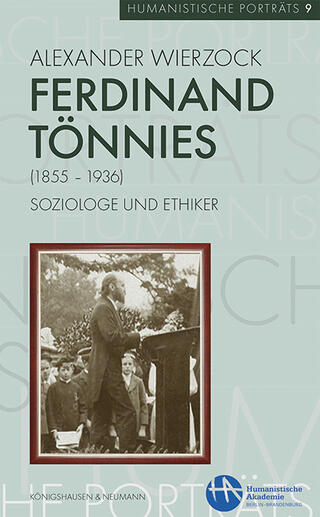
- Autor: Alexander Wierzock
- erschienen 2022 bei Königshausen & Neumann
- 98 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-7573-5
- 9,80 Euro
Ferdinand Tönnies war ein Mann der vielen Etikettierungen und gehörte mit Georg Simmel und Max Weber im frühen 20. Jahrhundert zu den bekanntesten deutschen Sozialwissenschaftlern. Mit diesen Weggefährten etablierte und repräsentierte Tönnies eine neue Disziplin: die Soziologie. Jenseits der akademischen Welt war der Soziologe der breiten Öffentlichkeit aber auch als moralische Instanz bekannt. Von Zeitgenossen wurde er als „bürgerlicher Moralapostel“ oder „socialistisch-ideologischer Weltverbesserer“ wahrgenommen. Noch ehe der Begriff des Intellektuellen geprägt wurde, stand Tönnies für jemanden, der gegen den Machtmissbrauch der Eliten kämpfte: Sein Ziel war eine menschlichere Gesellschaft jenseits kapitalistischer Ordnungen. Ebenjene Bestrebungen führten ihn im Jahr 1892 dazu, die Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur mitzubegründen. Die ideelle Basis seiner Ideen einer politischen Neuordnung fußten dabei in humanistischen Bildungs- und Erziehungsvorstellungen.
Über den Autor:
Alexander Wierzock promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Biografie über den Soziologen und Intellektuellen Ferdinand Tönnies (1855–1936). Er ist derzeit am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen im DFG-Projekt „Ferdinand Tönnies-Briefe: Eine digitale Edition“ beschäftigt.
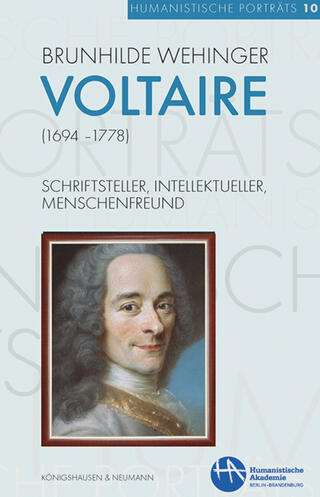
- Autorin: Brunhilde Wehinger
- erschienen 2024 bei Königshausen & Neumann
- 110 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-7884-2
- 12,80 Euro
Voltaire (1694–1778), französischer Dichter, Historiker, Philosoph, war Mitte des 18. Jahrhunderts die wichtigste Stimme der europäischen Aufklärung. Er hat entschieden zur Herausbildung der kritischen Öffentlichkeit beigetragen und wurde zum Vorbild des engagierten Schriftstellers. Sein Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit, sein Kampf gegen Intoleranz, religiösen Fanatismus, gegen die Ungleichheit vor dem Gesetz und gegen die Leibeigenschaft, sein philosophisches Denken, literarisches und journalistisches Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit im Namen der Menschlichkeit machten Voltaire zum Wegbereiter der Erklärung der Menschenrechte.
Die Autorin:
Brunhilde Wehinger ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und lebt in Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind deutsch-französische Literatur- und Kulturbeziehungen seit dem 18. Jahrhundert, das Denken der europäischen Aufklärung, französische Salon- und Konversationskultur sowie Geschichte und Rezeption weiblicher Autorschaft oder das wechselvolle Verhältnis von Literatur, Emanzipation und Gesellschaft. Bei Königshausen & Neumann erschien 2010 „Aufklärung in Geschichte und Gegenwart“, herausgegeben mit Richard Faber.
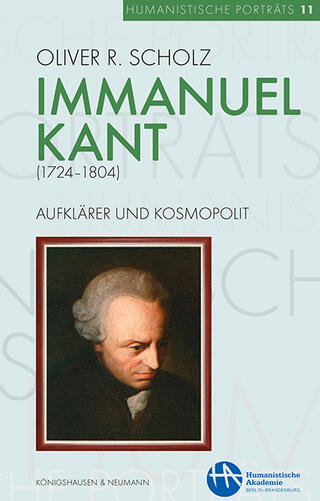
- Autor: Oliver R. Scholz
- erschienen 2024 bei Königshausen & Neumann
- 96 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-8744-8
- 9,80 Euro
Kants gesamte Philosophie dient der Begründung des Programms der Aufklärung. Als solche wendet sie sich an die gesamte Menschheit. Die Leitfrage ist: „Was ist der Mensch?“. Was ist insbesondere die moralische Bestimmung des Menschen? Dazu musste Kant in der theoretischen Philosophie zunächst fragen: „Was kann ich wissen?“, um dann in der praktischen Philosophie Antworten geben zu können auf die Fragen „Was soll ich tun?“ und „Was darf ich hoffen?“.
Kants Aufklärungsprogramm setzt voraus, dass Menschen frei zwischen Maximen wählen können. Zum Leitbegriff wird so die Idee der Freiheit in ihrem positiven Verständnis als Autonomie. Drei Ideen ergänzen sie: die Forderung nach einer Selbsterkenntnis der Vernunft und ihrer Grenzen; die Idee einer Gesetzlichkeit, sowohl des Reichs der Natur als auch des Reichs der Freiheit, und schließlich die Idee des Kosmopolitismus, das heißt, die Idee, dass wir als autonomiefähige Personen zugleich Weltbürger in einer gemeinschaftlichen Welt sind.
Kants Rechts- und Staatsphilosophie gipfelt in der Idee eines Weltbürgerrechts. Sie ist eine Lehre vom Weltfrieden. Das Denken des „Königsberger Weisen“ hat deutliche Spuren in Recht und Politik hinterlassen (Grundgesetz, Vereinte Nationen), in der „unvollendeten Aufklärung“ ist es von bleibender Aktualität.
Über den Autor:
Prof. Dr. Oliver R. Scholz unterrichtet Theoretische Philosophie am Philosophischen Seminar der Universität Münster. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Metaphysik, Sprachphilosophie sowie die Philosophie der europäischen Aufklärung.
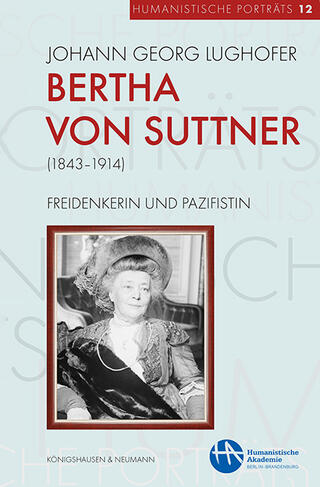
- Autor: Johann Georg Lughofer
- erschienen 2024 bei Königshausen & Neumann
- 86 Seiten, Broschur, Format: 13 x 21 cm
- ISBN: 978-3-8260-8748-6
- 9,80 Euro
Mit Bertha von Suttner ist eine herausragende Humanistin zu entdecken. Ihr Bestsellerroman „Die Waffen nieder!“ (1889) wurde weltbekannt: Die Autorin erlebte noch über 40 Auflagen neben Zeitungsveröffentlichungen – von einer Kinderzeitung bis zu Wilhelm Liebknechts „Vorwärts“. Dazu wurde das Werk in fast alle europäische Sprachen übersetzt, darunter nicht weniger als fünf verschiedenen Übertragungen ins Russische, wurde bereits 1913 verfilmt und sogar in Amerika zum Bestseller: ein seltener Fall in der deutschsprachigen Literatur.
Ihren Ruhm nutzte Suttner zum pazifistischen Aktivismus, wofür sie dann auch die erste Friedensnobelpreisträgerin wurde. Manche Schulen, Straßen und Plätze im deutschsprachigen Raum sind zwar nach ihr benannt. Auf der österreichischen 2-Euro-Münze wird sie ebenfalls erinnert. Doch insgesamt ist sie heute weitgehend aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwunden. Darum lohnt es sich gerade in einer Zeit, in der wieder ein schrecklicher und lange andauernder Krieg in Europa stattfindet und global aufgerüstet wird, in manchen Ländern liberale Errungenschaften zurückgenommen werden, sich mit den Gedanken der großen Freidenkerin und Pazifistin auseinanderzusetzen.
Über den Autor:
Johann Georg Lughofer, Assoc. Prof. Mag. Mag. Dr. MA (Exeter). Studium der Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaften und Philosophie in Wien, Granada, Nizza und Exeter. Lehrt seit 2005 an der Univerza v Ljubljani, Slowenien – dort 2009 Habilitation. Nebenbei Lehraufträge und Gastprofessuren an den Universitäten Maribor, Stellenbosch, Wien, Klagenfurt, Graz und Innsbruck.
Weiterhin in der Reihe geplant sind unter anderem:
- Max Sievers
- Ida Altmann-Bronn
- Octavio Paz
- Bruno Taut
- Karl Marx
Wie kann ich bestellen?
Richten Sie Ihre Bestellung bitte telefonisch oder per E-Mail an:
030 61 39 040
info@humanistische-akademie-bb.de
Sie können auch über die Webseite des Verlags Königshausen & Neumann bestellen:
Vielen Dank!
Ihre Ansprechperson
Sie haben Fragen zur Reihe „Humanistische Porträts“ der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg? Dann wenden Sie sich bitte an:
Was Sie noch interessieren könnte:
Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg
Adresse
Wallstraße 65
10179 Berlin
Kontakt
- Telefon:030 31 98 86 437
- E-Mail:info@humanistische-akademie-bb.de
- Gehe zur Website:www.humanistische-akademie-bb.de
